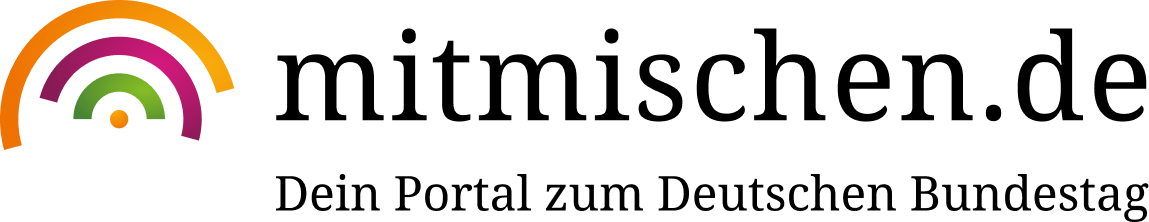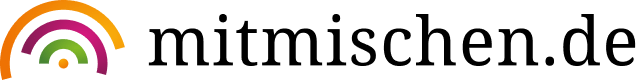Interview mit Norbert Lammert
Konflikte lösen, Konsens finden
Cora Dollenberg
Norbert Lammert war zwölf Jahre lang Präsident des Deutschen Bundestages, dem er insgesamt 37 Jahre als Abgeordneter angehörte. Was ihm am besten an der parlamentarischen Arbeit gefallen hat, wie Konflikte demokratisch gelöst werden und wie es seiner Meinung nach um Europa steht, hat mitmischen-Autorin Cora ihn im Interview am Rande des Europatages der Konrad-Adenauer-Stiftung in Aachen gefragt.

Norbert Lammert (CDU), Bundestagspräsident a.D., während der konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestages. © IMAGO / Christian Thiel
Die Beteiligungsrechte des Bundestages an europäischen Prozessen, über die er heute verfügt, haben sich erst im Kontext dieses Vertrages von Lissabon und seiner verfassungsgerichtlichen Überprüfung ergeben. Die Frage nach der demokratischen Legitimation Europas aber leidet bis heute unter dem Missverständnis, dass hier real existierende demokratisch verfasste Staaten mit einer Staatengemeinschaft verglichen werden. Die Europäische Union ist kein Staat, und soll nach dem erklärten Willen ihrer Mitglieder auch keiner werden, was man durchaus für ein Problem halten kann. Die Rechtslage jedenfalls ist eindeutig: Die berüchtigten Souveränitätsrechte liegen bei den Mitgliedstaaten und nicht bei der Europäischen Union.
Mit Blick auf diese bedeutsame Einschränkung zögere ich keinen Augenblick zu sagen, dass ich weltweit überhaupt keine Staatengemeinschaft erkennen kann, die es an demokratischer Legitimation mit der Europäischen Union aufnehmen könnte. Sie verfügt über demokratisch gewählte und damit unzweifelhaft legitimierte Gremien. An manchen Stellen geht der Legitimationsmechanismus innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft weiter, als das manche Mitgliedsländer für sich selbst gelten lassen wollen. Beispielsweise bedarf jeder einzelne von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Kommissare einer mehrheitlichen Zustimmung im Europäischen Parlament.
Die beste Antwort auf solche Fragen stammt vom früheren EU-Kommissionspräsidenten und langjährigen luxemburgischen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker. Er machte den Vorschlag, man solle jedes Jahr eine Woche lang den Zustand in Europa vor Beginn der Integrationsprozesse wiederherstellen. Mit all den damit verbundenen handfesten Erfahrungen: Alle paar hundert Kilometer eine Grenze passieren, Pässe vorzeigen, im Zweifelsfall Visa nachweisen. Selbstverständlich an jeder Grenze die mitgebrachte Währung in wiederum eine andere umtauschen und auf dem Rückweg wieder zurücktauschen. Arbeitserlaubnisse in anderen Ländern gar nicht oder nur mit hohem bürokratischem Aufwand erhalten. Und die Studienmöglichkeiten waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf die jeweiligen eigenen Staatsangehörigkeiten begrenzt. Die heutige junge Generation wird in der vermeintlichen Selbstverständlichkeit groß, dass es in Europa keine Grenzen gibt, dass wir fast alle eine gemeinsame Währung haben und dass wir uns alle auf gemeinsame Prinzipien der Organisation von Entscheidungsprozessen geeinigt haben. Und dass dazu jeder einen Rechtsanspruch – einen Rechtsanspruch! – darauf hat, dort zu leben, zu studieren oder zu arbeiten, wo es ihm in dieser europäischen Staatengemeinschaft am besten gefällt.
Ich meine, schon in meiner Schulzeit ein überzeugter, um nicht zu sagen glühender Europäer gewesen zu sein. Jedenfalls habe ich vor, und insbesondere nach meiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, alle Integrationsfortschritte innerhalb der wachsenden europäischen Staatengemeinschaft nicht nur mit Sympathie verfolgt, sondern wo immer möglich auch befördert. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Blick auf die großen Herausforderungen in Zukunft eher mehr Europa brauchen und nicht weniger.
Norbert Lammert
Prof. Dr. Norbert Lammert, 1948 in Bochum geboren, studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Neuere Geschichte und Sozialökonomie an den Universitäten Bochum und Oxford. 1975 promovierte er in der Parteienforschung. Er ist seit 1966 Mitglied der CDU und war von 1980 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Während dieser Zeit war er in verschiedenen Bundesministerien Staatssekretär, unter anderem im Wissenschafts-, Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Von 2002 bis 2005 war Prof. Dr. Norbert Lammert Vizepräsident, von 2005 bis 2017 Präsident des Deutschen Bundestags. Seit 2018 ist er Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die wichtigste Aufgabe besteht vielleicht darin, der jeweiligen Minderheit im Deutschen Bundestag zu ihren Rechten zu verhelfen. So steht ein Bundestagspräsident, der üblicherweise aus den Reihen der Mehrheit kommt, regelmäßig vor einer etwas ungemütlichen Aufgabe: Er muss den eigenen Kolleginnen und Kollegen deutlich machen, warum es in bestimmten Situationen nicht darauf ankommt, ihren Erwartungen Rechnung zu tragen, sondern den berechtigten Ansprüchen der Minderheit gerecht zu werden. Aber auch im Rückblick auf manche temperamentvollen Auseinandersetzungen ist uns das im Ganzen, glaube ich, gut gelungen. Überhaupt finde ich die Bereitschaft zum Kompromiss und zur Konsensfindung im Deutschen Bundestag ausgeprägter als in vielen anderen Parlamenten der Welt.
Heute herrscht die Meinung, die Debattenkultur sei erst in jüngster Zeit besonders rustikal und gelegentlich ruppig geworden. Aber auch in den ersten Jahren nach der Wahl des ersten Deutschen Bundestages ging es in Auseinandersetzungen durchaus handfest zu. Veränderte Diskussions- und Debattenstile der Gesellschaft finden sich prompt im Parlament wieder. Ich halte es zwar nicht für eine Errungenschaft, aber manche Veränderungen in der Art, Positionen zu beziehen, beobachten wir vor allem in den sozialen Medien. Die dort herrschende bemerkenswerte Ruppigkeit ist Ausdruck eines veränderten gesellschaftlichen Verständnisses, das folgerichtig auch in parlamentarischen Auseinandersetzungen seine Spuren hinterlässt.
Mit Blick auf unsere parlamentarischen Abläufe durch Verfahrensregeln, die durch Mehrheiten vereinbart werden. Sie stellen sicher, dass eine vorhandene Mehrheit der Minderheit nicht von vornherein Mitwirkungs- und Initiativrechte verwehrt oder diese beschneidet. Bis zur abschließenden demokratischen Mehrheitsentscheidung müssen Minderheiten alle ihr zustehenden Rechte haben und nutzen können, um durch eigene Initiativen, Änderungs- und Ergänzungsanträge auf den Urteils- und Entscheidungsprozess Einfluss zu nehmen.
Ich schließe mich besonders gerne einer Lektion an, die Barack Obama bei seiner Abschiedsrede so formuliert hat: „Die Demokratie ist immer dann am meisten gefährdet, wenn die Menschen beginnen, sie für selbstverständlich zu halten.“ Beinahe alle, die in diesem Land, schon gar im westlichen Teil leben, haben ausschließlich demokratische Verhältnisse kennengelernt. Sie neigen zu der voreiligen Schlussfolgerung, dies für den Normalfall der Geschichte zu halten. Es ist aber nachweislich weder der Normalfall der deutschen Geschichte, die über Jahrhunderte nicht demokratisch geprägt war, und deren erster Anlauf zu einer Demokratie auch früh und dramatisch scheiterte, noch ist es der Normalfall der Welt, in der wir leben. Unter den beinahe 200 Staaten dieser Welt gibt es kaum mehr als zwei Dutzend rundum demokratische Systeme, und wir gehören zu dieser Minderheit.

Cora Dollenberg
ist in NRW und Baden-Württemberg aufgewachsen, spricht aber weder Kölsch noch Schwäbisch, dafür Französisch, vor allem während ihres Studiums in Paris. Sie schreibt und spricht am liebsten über tagesaktuelle Politik und Literatur.