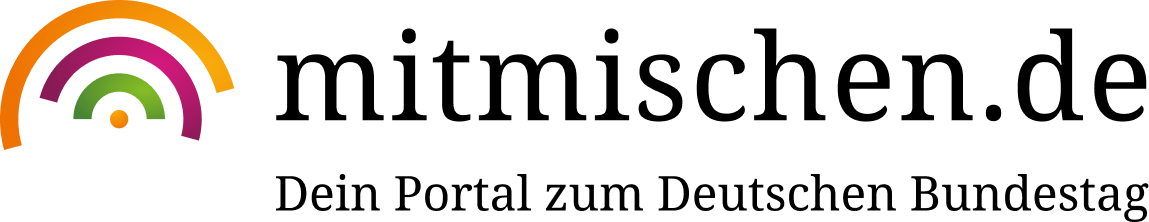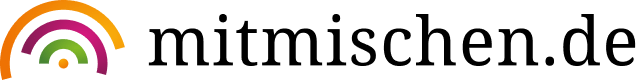Blog Tag 4
Und immer wieder Stacheldraht
„Aschedünger“ – dieses Wort fällt einem Jugendlichen ein, nachdem die Gruppe die Baracken von Auschwitz besichtigt und mit einer ehemaligen Zwangsarbeiterin gesprochen hat.

Fäkalien, Ungeziefer, Seuchen: Bis zu 700 Menschen mussten in einer Baracke leben. © DBT/Stella von Saldern
Über Nacht hat sich leichter Frost gebildet. Der Matsch unter meinen Schuhen ist hart. Ansonsten ist der Boden steinig und uneben. Es ist 9 Uhr und wir sind fast alleine auf dem größten Gelände der Massenvernichtung durch die Nationalsozialisten: das Lager Birkenau im heutigen Polen.
Vier Gaskammern mit anliegenden Krematorien wurden hier vor allem im Jahr 1944 rund um die Uhr betrieben. Heute sieht man nur noch deren Ruinen: Haufen aus Steintrümmern, die aus Gräben im Boden herausragen. Überhaupt steht kaum noch etwas im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, das sich für uns wie eine unendliche Weite anfühlt – zumindest so lange, bis wir irgendwann wieder an ein Ende gelangen, an den Stacheldrahtzaun und die Wachtürme. Egal, in welche Richtung man geht, irgendwann erreicht man immer den Stacheldraht.
Die Rampe
Mit unserer Gedenkstättenführerin kommen wir irgendwann an die sogenannte Rampe. Also an den Ort, an dem die Zug-Transporte ankamen. Hunderttausende deportierte Menschen aus ganz Europa wurden direkt von hier ins Gas geschickt. Sie stiegen aus den Viehwaggons, stellten sich auf in Reih und Glied. Diejenigen, die noch stark genug aussahen, wurden von der SS für die Zwangsarbeit ausgewählt und kamen in die Baracken. Alle anderen marschierten die wenigen Meter in ihren Tod. Die allermeisten waren Juden. Das Ganze dauerte kaum länger als eine Stunde. Kinder bis zu 14 Jahren hatten so gut wie keine Chance auf Überleben. Über 200.000 Kinder starben allein in Birkenau.

In solchen Waggons wurden Juden nach Auschwitz deportiert. © DBT/Stella von Saldern
Flöhe, Ungeziefer, Gestank
Walentyna Ignaszewska-Nikodem hat diesen Ort überlebt. Sie erzählt uns, wie sie als junge Frau in die Baracken von Birkenau kam, von den Flöhen, dem Ungeziefer, dem Gestank. Wer in den Baracken nah am Boden schlief, wurde von den Ratten angefressen, erinnert sie sich. Auch daran, dass es kein Wasser gab – weder zum Trinken noch zum Waschen. Die Notdurft musste sie anfangs draußen in Gräben verrichten. Erst später wurden Latrinen eingerichtet.
Nackt in die Kälte
Sie erzählt uns auch von Frau Drechsler, ihrer Aufseherin im Lager. Eine böse Frau sei das gewesen, mit nach vorne abstehenden Schneidezähnen. Brach eine Zwangsarbeiterin vor Erschöpfung zusammen, drückte sie Frau Drechsler mit ihren Stiefeln noch tiefer in den Dreck. Wer zu langsam war, wurde geschlagen. Immer wieder sei man gezwungen worden, sich ganz zu entkleiden, auch im Winter, berichtet Walentyna. Eines Tages, es war der 6. Dezember um vier Uhr in der Früh mussten alle Frauen aus ihrer Baracke nackt hinaus in die Kälte. Ein Test der SS sei das gewesen, meint sie: Wer das überlebte, war noch fähig zu arbeiten.

Walentyna Ignaszewska-Nikodem berichtet vom Leben im Lager. © DBT/Stella von Saldern
Das "Scheißkommando"
Bis zu 700 Menschen lebten zusammengepfercht in einer dieser Baracken, in der wir, die wir sie heute betreten, schon kaum Platz finden. Der Hunger und die Krankheiten führten zu Durchfall, der durch die Stockbetten sickerte, hinunter zu den anderen Häftlingen. Wer in den Latrinen arbeitete – man gehörte zum "Scheißkommando" – war vor den Grausamkeiten der SS geschützt, da man so sehr stank. Kein Deutscher wollte diesen Menschen zu nahe kommen, keiner wollte sie schlagen, erzählt uns unser Guide. Im Scheißkommando arbeiten zu dürfen galt geradezu als Traumjob in Auschwitz.
Die Flöhe in den Haaren
All diese Dinge müssen wir uns heute hinzudenken. Die allermeisten Baracken stehen nicht mehr, in der Luft liegt kein Rauch, niemand schreit vor Schmerzen. Die Weite des Verbrechens liegt still vor uns. Der Boden ist ausgehärtet – keine Spur von den zehntausenden Füßen, die hier bei Regen im Schlamm versanken.
Walentyna erzählt von einer Gruppe von Zwangsarbeitern, die jeden Tag Brennnesseln für die Lagersuppe pflücken mussten – ohne Handschuhe. Ob sie während dieser grausamen Zeit im Lager jemals ihren Verlobten vermisst hätte, fragt Charlotte (22) aus Berlin während unseres Gesprächs mit Walentyna. Diese schmunzelt kurz: "Eigentlich nicht", sagt sie, "dafür hatte ich keine Kraft und keine Zeit. Wir mussten alle versuchen, zu überleben und uns gegenseitig zu helfen. Woran wir vor allem dachten, war dass wir uns gegenseitig die Flöhe aus den Haaren zupfen müssen".

Heute stehen nur noch wenige Baracken auf dem Gelände von Birkenau. © DBT/Stella von Saldern
Aschedünger
Auf unserem Weg durch das Gelände von Birkenau halten wir an einem Teich. Hier musste das Sonderkommando tagtäglich die Asche der Toten hineinkippen. (Mehr über das Sonderkommando könnt ihr in einem anderen Blog-Beitrag lesen.)
Später sitzen wir zusammen in einer Reflexionsrunde und erinnern uns an diesen Moment am Teich: an das trübe Wasser und die Pflanzen drumherum. Wir werfen einzelne Wörter in den Raum, die uns in den Sinn kommen. Johannes (22), Azubi aus Chemnitz, sagt folgendes Wort: "Aschedünger". Und wir alle verstehen, was er meint. Die Toten sind in den Boden von Birkenau eingegangen – und aus dem Boden entstand neues Leben: Pflanzen, Wiesen, Bäume. Auschwitz-Birkenau ist nicht nur der Ort, an dem das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte stattfand. Auschwitz-Birkenau ist ein Friedhof, das wird mir in diesem Moment ganz deutlich bewusst.
Im Matsch versunken
Auf unserem Weg zurück erkennen wir schon aus der Ferne, dass sich das Birkenau-Gelände mit Besuchergruppen gefüllt hat. Über drei Stunden waren wir unterwegs und hatten uns weit vom Eingangstor entfernt. In der Zwischenzeit kam die Sonne raus, der Boden wurde weich und meine Schuhe sinken in den Matsch.