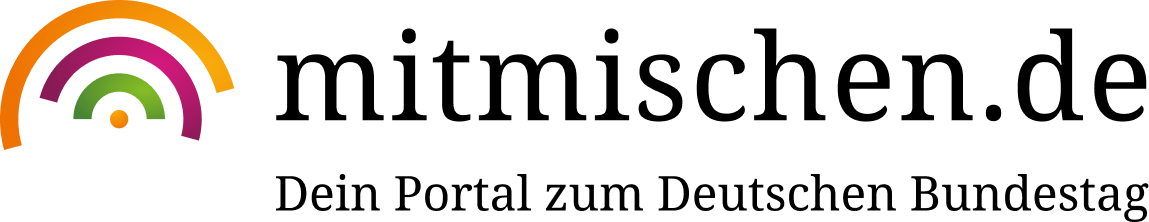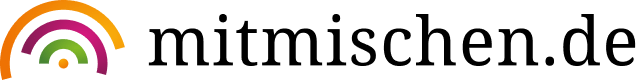Abwrackwerft
Schwimmender Schrott
Helene Fuchs
Rund 9.000 Schiffe durchqueren pro Jahr Hamburgs Hafen, den größten Seehafen Deutschlands. Doch was passiert eigentlich, wenn Boote zu alt fürs Wasser sind? Helene hat eine Abwrackwerft in Hamburg besucht – und Riesen-Scheren entdeckt.

Die Leute von Miersen rücken kleinen Kähnen mit Scherenbaggern zu Leibe © Fa. Miersen
Von Baggern und Sägen
Am südlichen Rand des Hamburger Hafens, abgelegen und direkt an der Elbe, dröhnt ein Bagger. Auf dem unbefestigten Gelände der Firma Miersen, zwischen verlassenen Häusern, schwimmt ein kleines Schiff im Fluss und wird gerade auseinandergesägt. Der Chef hier ist Heiko Miersen, er begann 1987 die Firma aufzubauen. Über Zufälle kam er damals auf sein heute genutztes Gelände in Hamburg-Moorburg, für das es damals bereits die Erlaubnis gab, dort Schiffe in ihre Einzelteile zu zerlegen, also eine Abwrackgenehmigung.
Kurzerhand erweiterte der Schrotthändler seinen Tätigkeitsbereich. Heute sei das Familienunternehmen der einzige Anbieter in Deutschland, der Schiffe korrekt entsorgt, sagt Miersen. Hauptsächlich Binnen- und Küstenschiffe, die meist um die 400 bis 500 Tonnen schwer sind und maximal 120 Meter lang. Das größte Schiff, dass dort abgewrackt wurde, war ein Eimerkettenbagger, eine Art schwimmender Riesenbagger, der mal 2.500 Tonnen wog.
Von Gezeiten abhängig
Eine große Werft findet sich nicht in Moorburg, nur ein kleines Haus für die Verwaltung. Das ganze Jahr über arbeitet man hier ansonsten unter freiem Himmel, die Arbeitszeiten sind streng getaktet. Denn der Wasserstand diktiert den Tagesrhythmus der Firma und der Tidenkalender gibt schon ein Jahr im Voraus vor, wann genau die Schiffe abgewrackt werden können. Pünktlich drei Stunden vor Niedrigwasser wird hier begonnen, dann bleiben Heiko Miersen und seinen Angestellten etwa sechs Stunden zum Arbeiten, bevor das Wasser wieder ansteigt.
An neuen Aufträgen mangelt es ihnen dabei nicht. Fragt ein Schiffsbesitzer bei ihm an, meist sind das kleinere Reedereien, dann rechnet Miersen zunächst einmal: Tiefgang und Größe entscheiden darüber, ob das Schiff überhaupt auf das Gelände passt; maximal 120 Meter darf es lang sein und zwei Meter Tiefgang haben. Der Bereich der Elbe, in dem das Unternehmen arbeiten darf, fasst keine größeren Schiffe.
So sauber wie möglich
Außerdem muss je nach Bauart beurteilt werden, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Die Kosten für die Abwrackung werden mit dem Preis, der für die übrig gebliebenen Teile erzielt wird, verrechnet. Rentabel ist das nicht immer. Auch deshalb lassen so viele Reedereien ihre Schiffe im Ausland recyceln – dort sind die Auflagen viel weniger streng, die Arbeitsstunden nicht so gut bezahlt.
Das Team von Miersen schaut sich das Schiff vor Ort an, dann müssen erst alle wassergefährdenden Stoffe, wie beispielsweise übrig gebliebenes Öl, aus dem Schiff entfernt und der Körper gereinigt werden. "Wir geben unser Bestes, so sauber wie möglich zu arbeiten", erzählt Mats Miersen, Sohn des Gründers und Mitarbeiter der Firma. Einfach sei das aber nicht. Erst wenn alle Flüssigkeiten entfernt sind, darf das Schiff in die Abwrackwerft, ansonsten würden die giftigen Stoffe in das Gewässer abfließen.
Die Riesen-Scheren
In der Weft beginnt dann die richtige Arbeit: Der reine Stahlkörper wird von einer Plattform aus mit einem riesigen Bagger mithilfe hydraulischer Scheren in Stücke zerschnitten. Von diesem Gerüst bleibt nach und nach immer weniger übrig. Der Rest des Schiffes muss währenddessen vom Trupp weiterhin im Wasser behalten werden. Keine einfache Aufgabe. Gleichzeitig werden auch an Bord Teile von Hand zerkleinert, die großen Schiffsteile an Land gehoben und dort immer weiter zerstückelt. Dann wird es laut im eigentlich idyllischen Moorburg.
Und das ist der einfache Fall. Denn ist ein Schiff besonders gut verbaut, müssen zusätzlich noch Brennarbeiten vorgenommen werden. "Dann qualmt's", erklärt Mats Miersen. Die Arbeit ist gefährlich, denn der Zugang zum Schiff ist vom Land aus schwierig. Ohne Sicherheitsschuhe, Warnweste und Helm darf niemand in die Nähe. Für eine Winde, um die Schiffe an Land ziehen zu können, gibt es von der Stadt keine Genehmigung. "Wir arbeiten hier im Prinzip noch wie 1980", beschreibt es Mats Miersen.
Von Beruf Schiffsabwracker?
Was nach diesem anstrengenden Prozess übrig bleibt, verladen die Arbeiter in Lastwagen. In Stahlwerken in Hamburg oder Bremen werden die Teile eingeschmolzen, zu große Stücke gehen nach einem Zwischenstopp im Hamburger Exportlager in die Türkei oder nach China. Im Monat wrackt die Firma circa drei Schiffe ab, je nach Auftragslage und Projekten können es bis zu 100 im Jahr werden. Miersen hat sogar bereits einen Minensucher der Bundeswehr abgewrackt, erzählt er hörbar stolz. Je nach Projekt arbeiten zehn bis 20 Leute an einem Schiff, der Bagger ersetzt dabei etwa fünf Menschen. Eine spezielle Ausbildung haben die Angestellten nicht. Trotzdem ist Nachwuchs schwierig zu finden. Auch Bewerbungen von Frauen hatte Mats Miersen noch nie.
Im Graubereich
Immer wieder stoße er außerdem auf Widerstand bei den Behörden, erzählt Miersen. Die Arbeit der Firma finde in einem Graubereich statt. Eine fachgerechte Entsorgung für Schiffe sei im Grunde gar nicht möglich, denn "in der Behörde will niemand dafür zuständig sein, Vorschriften gibt es kaum oder gar nicht", erzählt Mats Miersen. Die meisten Qualifikationen für den Job hat er sich selbst angeeignet und gelernt, worauf bei den verschiedenen Schiffstypen zu achten ist.
Unsichere Zukunft
Eigentlich würde er gern den Familienbetrieb weiterführen. "Das zu übernehmen, ist mein Traum", berichtet der Hamburger. Um die Aufträge muss er sich mit dem Seehafen der Stadt vor der Tür keine Sorgen machen. Allein im vergangenen Jahr hätten sie drei havarierte Schiffe zum Abwracken gehabt. Ohne das Unternehmen lägen die jetzt auf dem Grund der Elbe, schildert Mats Miersen.
Auch für 2019 melden sich schon Kunden. Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, weiß Miersen noch nicht. Denn ohne große Investitionen schafft er die Arbeit mit den wenigen Mitarbeitern kaum. "Da brauchen wir viel mehr Unterstützung vom Staat", fordert er. Dann klappe es auch mit dem Recycling im Einklang mit der Umwelt.
Helene Fuchs
Helene Fuchs
studiert Recht und Politik