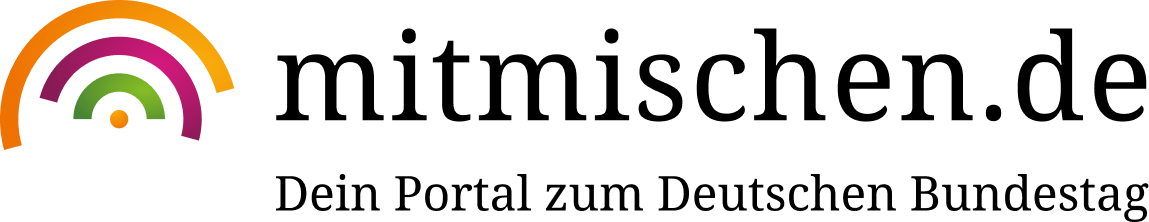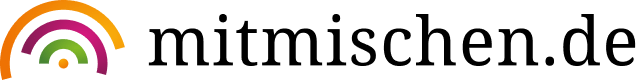Extremistische Gewalt
„Viele Opfer entwickeln Vermeidungsstrategien“
Wie hilft man den Opfern extremistischer Übergriffe? Robert Kusche vom Dachverband der Beratungsstellen erklärt, womit Betroffene zu kämpfen haben und welche Unterstützung sie bekommen.

„So ein Angriff ist auch immer eine Botschaft an die gesamte Community: Ihr seid hier nicht erwünscht“, sagt Robert Kusche. © privat
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir als unabhängige Beratungsstellen haben für das Jahr 2021 bundesweit knapp 1.400 Fälle gezählt. Diese Zahl berücksichtigt allerdings nur Ostdeutschland, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In den westdeutschen Bundesländern werden die Beratungsstellen noch nicht so lange gefördert. Deshalb sind sie teilweise noch im Aufbau.
Die 1.400 Fälle sind natürlich nur die, die gemeldet wurden. Es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Das Bundeskriminalamt hat mit einer sogenannten Dunkelfeld-Studie potenziell Betroffene nach ihren Gewalterfahrungen befragt. Heraus kam, dass man davon ausgehen muss, dass pro Jahr an die 245.000 rassistisch motivierte Körperverletzungen stattfinden, die aber eben größtenteils nicht gemeldet werden.
Hier findet ihr die Statistiken des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Das hat verschiedene Gründe. Viele wissen einfach nicht, an wen sie sich wenden können. Dann gibt es oft eine große Hemmschwelle, zur Polizei zu gehen. Die Betroffenen gehören in der Regel marginalisierten Gruppen an und haben mitunter schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Oder sie denken: Wie soll die Polizei mir helfen? Die Täter sind sowieso nicht greifbar.
Unser Ansatz ist, proaktiv auf Betroffene zuzugehen und ihnen ein Beratungsangebot zu machen. Deshalb recherchieren wir täglich Fälle. Wir gucken in Polizeimeldungen und Medienberichte. Wir bitten unsere Netzwerke, uns Vorfälle zu melden. Wir beraten zur Anzeigeerstattung und zeigen Möglichkeiten auf – die Wichtigkeit und die Vorteile auf der einen Seite, aber auch die potentiellen Nachteilen und Risiken auf der anderen Seite. Die Entscheidung liegt letztlich aber bei den Betroffenen, die sie mit diesen Informationen hoffentlich besser treffen können.
In Sachsen haben wir im Jahr 328 Beratungsfälle. München hatte zum Beispiel 2020 mehr als 215 Ratsuchende. Die Erfahrung zeigt: Wo es Beratungsstellen gibt, werden sie auch in Anspruch genommen.
Das ist eine etwas andere Form von Gewalt als bei üblichen Fällen von Körperverletzung. In der Wissenschaft nennen wir das Botschaftsverbrechen. Das bedeutet, dass die Betroffenen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten abgewerteten Gruppe ausgewählt werden. In der Regel kennen Täter und Opfer sich nicht persönlich. Die Betroffenen werden im öffentlichen Raum angegriffen, etwa weil sie ein Kopftuch oder eine Kippa tragen oder weil sie schwarz sind.
Die Opfer sind natürlich individuell betroffen: Sie wurden angegriffen und körperlich versehrt. Aber darüber hinaus ist es auch immer eine Botschaft an die gesamte Community: Ihr seid hier nicht erwünscht. Damit sind diese Angriffe auch immer ein gesamtgesellschaftliches Problem. Denn die Täter zeigen damit, dass sie unsere freiheitliche Demokratie ablehnen, in der es darum geht, Menschenrechte zu schützen und jedem die Freiheit zu ermöglichen, so zu leben, wie er oder sie will.
Eine große Frage ist natürlich: Was kann ich jetzt tun? Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich? Wir begleiten die Opfer zur Polizei, wenn sie Anzeige erstatten wollen. Und wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, begleiten wir auch dorthin.
Wir wollen die Betroffenen auch darin unterstützen, einen Umgang mit dem Geschehenen zu finden. Bei vielen ist es so, dass sie Vermeidungsstrategien entwickeln, dass sie zu bestimmten Tageszeiten nicht mehr auf die Straße gehen oder bestimmte Orte nicht mehr aufsuchen aus Angst, wieder zum Opfer zu werden. Wir versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.
Zusätzlich machen wir auch fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit – natürlich nur, wenn die Betroffenen das wollen. Wir versuchen, die Gesellschaft zu sensibilisieren, aufzuklären, mit Lokalpolitikerinnen und -politikern zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, wie man beispielsweise Jugendliche stärken kann.
Wir haben Büros in Dresden, Chemnitz, Leipzig und Görlitz. Dort arbeiten jeweils Dreier-Teams. Die meisten haben einen sozialpädagogischen Abschluss. Manche haben auch einen politikwissenschaftlichen Hintergrund. Viele haben sich zu Traumafachpädagoginnen oder psychosozialen Prozessbegleitern weiterbilden lassen.
Wir machen In-House-Schulungen im Rechtsbereich. Rechtsberatung dürfen wir aber nicht anbieten. Deshalb verweisen wir an Anwältinnen und Anwälte weiter, die im Feld der voruteilsmotivierten Gewalt und der Nebenklage versiert sind. Ähnlich ist es im psychologischen Bereich: Auch da verweisen wir an Psychologinnen und Traumatherapeuten.
Der Dachverband wurde 2014 gegründet. Hintergrund war, dass damals das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ aufgelegt wurde, mit dem erstmals auch Strukturen in Westdeutschland gefördert wurden. Das Framing bis dahin war gewesen: Rechte Gewalt gibt es vor allem im Osten. Das stimmt natürlich nicht und wurde damit ein Stück weit korrigiert.
Auch vor 2014 gab es schon eine Vernetzung der ostdeutschen Beratungsstellen. Der Austausch ist total wichtig, weil das, womit wir uns beschäftigen, ein relativ junges Themenfeld der sozialen Arbeit ist. Im Dachverband geht es um Fachaustausch, Qualitätssicherung und um Professionalisierung. Wir schulen Beraterinnen und Berater. Und wir versuchen uns gemeinsam einzubringen – etwa bei der Entstehung des Demokratiefördergesetzes.
Unsere Kritik ist, dass diese Formulierung recht vage und offen ist. Die Idee eines Demokratiefördergesetzes ist unter anderem aus dem NSU-Untersuchungsausschuss hervorgegangen. Der forderte damals, die Strukturen der Opfer-Beratung zu stärken. Da ging es sehr explizit um die Opfer rassistischer, rechtsextremer und antisemitischer Gewalt. Die Bundesinnenministerin sagt ja auch, dass rechte Gewalt eine der größten Bedrohungen für unsere Demokratie ist.
Wir finden, dass man das auch klar benennen muss. Unser Vorschlag ist, die Formulierung „Opfer rassistischer, rechtsextremer und antisemitischer Gewalt“ an die erste Stelle zu stellen. Wir wissen natürlich, dass es auch Opfer anderer Gewalt gibt und natürlich sollen die auch Beratungsleistungen in Anspruch nehmen können. Deshalb schlagen wir die folgende Ergänzung vor: „sowie Opfer von Ideologien der Ungleichwertigkeiteit“.
Langfristige Unterstützung. Ein Kritikpunkt ist, dass im jetzigen Entwurf keine Mindestsumme steht. Das heißt, der Bundestag wird jedes Jahr im Laufe der Haushaltsverhandlungen eine neue Fördersumme festlegen. Wir finden aber, dass sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass das ein Dauerthema ist. Wenn man langfristig und nachhaltig fördern will, sollte man auch eine Summe ins Gesetz schreiben.
Neben einer konstanten Unterstützung wünsche ich mir vor allem eine stärkere Wahrnehmung der Betroffenen. Nach schlimmen rechtsextremen Anschlägen äußert die Politik sich zuverlässig und ist auch vor Ort. Aber viele der Betroffenen und Hinterbliebenen engagieren sich inzwischen aktiv. Deren Perspektive muss nachhaltiger einbezogen werden in den politischen Prozess. Es ist Zeit, sie als Akteure wahrzunehmen, nicht nur als Betroffene.
Robert Kusche
Robert Kusche ist Geschäftsführer der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen e.V. und im Vorstand des Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Der VBRG berät und unterstützt in allen Bundesländern direkt und indirekt Betroffene, ihre Angehörige und Zeuginnen und Zeugen von Übergriffen.
Eine Übersicht der Beratungsstellen findet ihr hier.