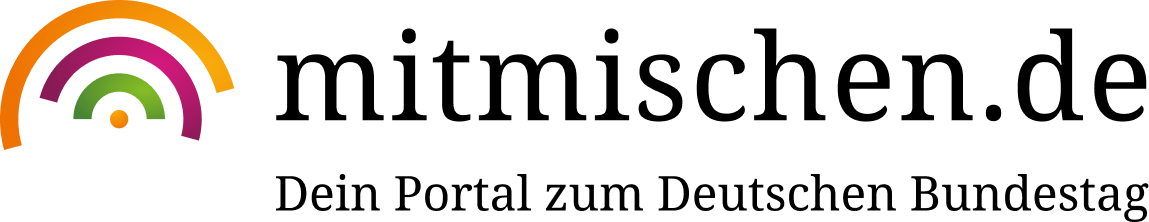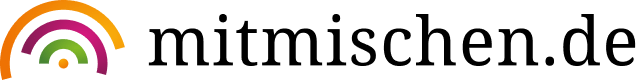Carsten Schneider (SPD)
„Ein realistisches Bild vom Osten zeigen“
Es existierten immer noch viele Vorurteile zwischen Ost- und Westdeutschen, findet Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Wie sich das ändern lässt, erklärt er im Interview.

„Die deutliche Mehrheit der Ostdeutschen steht für Demokratie ein“, sagt Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung. Das müsse man besonders in den Blick nehmen.© Bundesregierung/Steffen Kugler
Sie sind Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. Warum braucht es dieses Amt 32 Jahren nach der Wiedervereinigung noch?
Es gibt immer noch einen besonderen politischen Entscheidungsbedarf für Ostdeutschland, weil leider immer noch markante wirtschaftliche und soziale Unterschiede existieren. Wir wollen wirklich gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land schaffen. Die gibt es derzeit noch nicht. Nicht nur deshalb haben viele Ostdeutschen schlechtere Lebenschancen. Häufig fehlt neben finanziellen Ressourcen auch das Vitamin B, also die richtigen Kontakte und Netzwerke. Meine Aufgabe ist es, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und politische Antworten zu formulieren.
Ihr Bericht zur Lage in Ostdeutschland trägt den Untertitel „Ein neuer Blick“. Was ist neu daran?
Ich glaube, viele Menschen im Westen haben sich nie intensiv mit der ostdeutschen Perspektive beschäftigt. Einer aktuellen Umfrage zufolge waren 22 Prozent der Westdeutschen leider noch nie im Osten. Vieles ist immer noch klischee- und vorurteilsbeladen – auf beiden Seiten.
Mir geht es darum, ein realistisches Bild von Ostdeutschland zu zeigen. Deshalb habe ich 16 Autorinnen und Autoren gebeten, ihre Sicht, ihr Ostdeutschland zu beschreiben und zu erklären. Daraus sind Berichte des Aufbruchs und des Durchsetzens entstanden, spannende Texte über die vergangenen 30 Jahre, aber auch über das Heute. Dieser Blick lohnt sich. Es geht mir darum, die Menschen einzuladen, nach so vielen Jahren noch mal genauer hinzuschauen, neugierig zu sein aufeinander – und auch stolz auf das, was wir in Deutschland gemeinsam erreicht haben.
Sie betonen die Potentiale des modernen Ostdeutschlands. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass einige Probleme dort brisanter sind als in Westdeutschland, zum Beispiel demokratiekritische Tendenzen und rechtsextreme Gesinnungen. Was kann man dagegen tun?
Indem man eben ein vielschichtiges, ein realistisches Bild zeichnet. Oft habe ich den Eindruck, man zeigt auf den Osten und spricht damit den Westen frei, nach dem Motto: Bei uns gibt es keinen Rechtsextremismus. Das stimmt aber nicht, das hat ja gerade das Wahlergebnis der AfD in Niedersachsen wieder gezeigt. Ich zitiere aus Kraftklubs ‚Wittenberg ist nicht Paris‘: „Nazis raus ruft es sich leichter, da wo es keine Nazis gibt.“ Dort, wo viele Nazis sind, ist es umso wichtiger, diejenigen zu unterstützen, die für die Demokratie einstehen – und das ist die deutliche Mehrheit in Ostdeutschland. Die will ich besonders in den Blick nehmen und stärken.
Sie haben das Thema Geld schon kurz angesprochen: Nach wie vor sind die Löhne in Ostdeutschland geringer. Der Fachkräftemangel ist dagegen höher als im Westen. Was plant die Bundesregierung, um den Osten attraktiver zu machen, gerade für junge Leute?
Wir brauchen eine selbstbewusste Arbeitnehmerschaft, die sich organisiert und für ihre Interessen eintritt und streitet. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber in den vergangenen 30 Jahren gab es in Ostdeutschland gerade unter CDU-Führung oft Niedriglohn-Strategien und wenig Unterstützung für Betriebsräte, Mitbestimmung, gute Arbeitsplätze. Diese benötigen wir aber, denn nur so kommen gute Leute hierher.
Deshalb legt die Fachkräftestrategie der Bundesregierung einen Schwerpunkt auf Ostdeutschland. Da geht es zum einen darum, den zwei Millionen Menschen, die in den Westen gegangen sind und dort ihr Glück gemacht haben, ein Angebot zu machen, damit sie zurückzukommen. Zum anderen brauchen wir aber auch gesteuerte Zuwanderung aus dem Ausland. Ostdeutschland muss weltoffener werden.
In Ihrem Bericht fordern Sie unter anderem „Mehr Ostdeutsche in Führungspositionen!“. Genauso wie in der Wirtschaft sind auch in der Bundespolitik wesentlich weniger Ostdeutsche als Westdeutsche in wichtigen Positionen. Wie kann man da gegensteuern?
In der Politik ist es noch mit am besten. Sehr schlecht ist die Situation in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und auch im Journalismus. Dafür muss man sensibilisieren, denn vielen ist gar nicht bewusst, dass nur 3,5 Prozent der Spitzenpositionen von Ostdeutschen besetzt sind, obwohl sie 19 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Man muss also sensibilisieren, einfordern und die Leute stärken, ihnen Angebote machen – auch in der Bundesverwaltung.
Sie schreiben von „Mentalitätsunterschieden zwischen Ost und West, die es nach wie vor gibt“. Gilt das aus Ihrer Sicht auch für die junge Generation, die ein geteiltes Deutschland nie erlebt hat?
Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber: Ja. Mein Bruder ist 1992 geboren, definiert sich aber als Ostdeutscher. Jede Region hat ja ihre Besonderheiten. Ein Ostfriese ist anders als ein Oberbayer.
Die ostdeutsche Identität ist natürlich geprägt von 40 Jahren DDR, aber auch von den letzten 30 Jahren, wo sich in Westdeutschland einiges geändert hat – im Osten aber alles. Wir haben ein komplett neues System etabliert, wir haben große soziale Unsicherheit und viele Brüche erlebt. Das haben die Kinder ja am Beispiel ihrer Eltern mitbekommen. Da saß der Vater am Küchentisch, der gerade noch als Ingenieur beruflich eingebunden gewesen war und plötzlich arbeitslos wurde, der sich deshalb verändert hat und vielleicht sogar abgerutscht ist. So waren die 1990er Jahre für viele eine harte, brutale Erfahrung. Das prägt.
Sie selbst sind 1976 in Erfurt geboren. Als die Mauer fiel, waren Sie 14. Wie würden Sie heutigen 14-Jährigen erklären, was Sie aus dieser Zeit gelernt haben?
Dass Freiheit und Demokratie einem nicht in den Schoß gelegt werden. Dass man als Bürger dieser Gesellschaft dafür kämpfen muss. Dass man nicht zu viele Vorurteile haben darf, nicht nur in den eigenen Informationsblasen leben sollte, sondern sich auch mal in andere hineinversetzen muss. Dass man sich auf den Aushandlungsprozess einlassen muss, wie man miteinander leben will.
Man sieht es jetzt an der Ukraine: Dort kämpfen die Menschen für diese Freiheit. Das Eis ist dünn, nichts ist gottgegeben. Ich habe eine Gesellschaft komplett implodieren sehen. Und ich möchte, dass unsere Gesellschaft, in der ich sehr gerne lebe, stabil bleibt. Das schafft die Politik aber nicht allein. Der Staat lebt von der Voraussetzung, dass die Menschen ihn mitgestalten.
Zur Person
Carsten Schneider wurde 1976 in Erfurt geboren. Nach der Schule machte er eine Banklehre. Seit 1995 ist er Mitglied in der SPD, seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages. Schneider ist Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. Mehr erfahrt ihr auf ihrem Profil auf bundestag.de.
(Julia Karnahl)