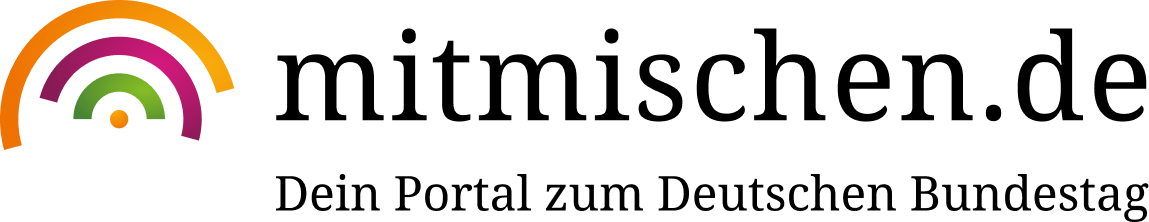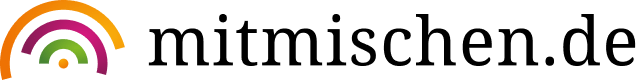Überhangmandat
Auch wenn die Überhangmandate mit der Wahlrechtsreform 2023 abgeschafft wurden, erklären wir euch hier, wie diese zustande kamen und warum sie dazu beigetragen haben, dass mehr als die eigentlich nach dem Grundgesetz vorgesehenen 598 Abgeordneten in den Bundestag einziehen konnten.
Bei der Bundestagswahl können die Menschen in Deutschland zwei Stimmen abgeben. Mit der ersten Stimme wählen sie einen Politiker aus ihrem Wahlkreis. Diese Politiker nennt man auch Direktkandidaten oder Wahlkreisbewerber. Mit der zweiten Stimme wählen die Bürgerinnen und Bürger eine Partei. Diese Stimme wird auch Zweitstimme genannt.
Die Ergebnisse bei den Zweitstimmen sind das, was wir am Wahlabend hören: Partei x hat soundsoviel Prozent der Stimmen bekommen, Partei z hat soundsoviel Prozent der Stimmen bekommen. Die Anzahl der Zweitstimmen entscheidet also darüber, wie die Sitze im Parlament prozentual verteilt werden.
Was früher galt
Bis zur Wahl 2021 galt: Der Direktkandidat, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erhielt, gewann ein Direktmandat und bekam auf jeden Fall einen Sitz im Bundestag. Alle anderen Plätze wurden mit Politikern über sogenannte Landeslisten der Parteien besetzt. So entstanden in der Vergangenheit Überhangmandate. Denn wenn viele Menschen ihre beiden Stimmen nicht derselben Partei gegeben haben und so eine Partei bei der Wahl zum Bundestag mehr Direktmandate über die Erststimmen erhielt, als ihr Sitze im Bundestag gemäß der Anzahl der Zweitstimmen zustanden. Das hatte zur Folge, dass der Bundestag sich vergrößerte. Die jeweilige Partei konnte also mehr Mitglieder ins Parlament schicken, als ihr durch den Anteil an Zweitstimmen zustand. Durch die Vergabe zusätzlicher Sitze an die anderen Parteien – sogenannte Ausgleichsmandate – wurde die Sitzverteilung nach dem Verhältnis der Zweitstimmen ausgeglichen. Am 17. März 2023 hat der Bundestag mehrheitlich beschlossen, bei künftigen Bundestagswahlen Überhang- und Ausgleichsmandate abzuschaffen.
Was aktuell gilt
Am 23. Februar 2025 galt erstmals zu einer Bundestagswahl für Wahlkreissieger die zusätzliche Anforderung der sogenannten „Zweitstimmendeckung“. Das heißt, dass eine Partei künftig nur noch so viele direkt in ihren Wahlkreisen gewählte Kandidaten in den Bundestag entsenden kann, wie ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Liegt die Zahl ihrer Wahlkreissieger darüber, entscheidet die Reihenfolge der Höhe von deren Erststimmenergebnissen, wer von ihnen tatsächlich ins Parlament einziehen darf. Wahlkreise, deren Erststimmensieger dabei nicht zum Zuge kommen, werden dann im Bundestag von keinem direkt gewählten Abgeordneten vertreten sein. Das hat die Ampel bei ihrer Reform in Kauf genommen, um so die Zahl der Abgeordneten verlässlich auf 630 zu begrenzen.