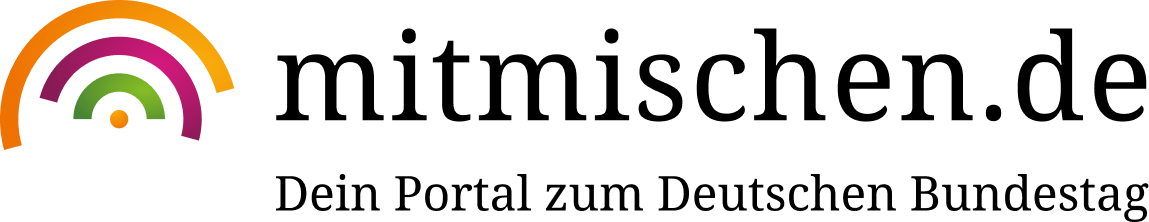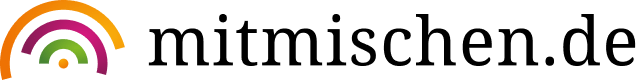Medizin
Organspender gesucht
In Deutschland gibt es zu wenige Organspender. Aber nicht, weil die Menschen sich weigern, sondern einfach, weil sie sich nicht aktiv dafür entscheiden. Was ist da zu tun? Die Abgeordneten diskutierten über verschiedene Modelle.

Auch Promis wie die Schauspielerinnen Xenia Assenza (links) und Jennifer Ulrich, machen sich immer wieder für den Organspendeausweis stark. Ohne den geht nämlich nix. © dpa
Nur ein Drittel
Die Zahlen sind erschreckend: In Deutschland warten derzeit mehr als 10.000 Patienten auf ein Spenderorgan. Doch 2017 konnten hierzulande gerade einmal 3.385 Organe transplantiert werden. Bei Lungen, Lebern oder Nieren gibt es also offenbar massive Probleme – das beschäftigt auch die Abgeordneten im Bundestag.
Am 28. November trafen sich die Abgeordneten zu einer vereinbarten Debatte, um zu überlegen, wie mehr Menschen dazu gebracht werden können, nach ihrem Tod Organe zu spenden. Denn das ist der Knackpunkt: Die meisten wichtigen Organe hat der Mensch nur einmal, kann sie also schlecht zu Lebzeiten hergeben.
Entscheidung versus Widerspruch
Wenn jemand nach dem Tode Leber, Herz, Lunge oder Bauchspeicheldrüse spenden will, muss er zu Lebzeiten aktiv zustimmen. Er oder sie muss sich also einen Organspendeausweis zulegen. Darin ist vermerkt, ob die Organe der betreffenden Person nach deren Tod anderen Menschen transplantiert werden dürfen. Hat jemand keinen solchen Ausweis – und das betrifft mehr als zwei Drittel der Deutschen –, heißt das automatisch: Sie dürfen nicht.
In einigen anderen Ländern gibt es die sogenannte Widerspruchslösung und die funktioniert genau umgekehrt: Eine Spende ist nur dann verboten, wenn die betreffende Person zu Lebzeiten aktiv festgehalten hat, dass sie nicht spenden will. Trifft jemand keine Aussage, heißt das automatisch: Es darf transplantiert werden.
Die Hauptfrage ist also: Bleiben wir bei der Entscheidungslösung oder führen wir die Widerspruchslösung ein?
Union gegen Widerspruchslösung
Karin Maag (CDU/CSU) sagte in der Debatte, 80 Prozent der Bevölkerung stünden der Organspende positiv gegenüber. Die mangelnde Spendenbereitschaft sei somit gar nicht das Problem. Vielmehr fehle es in Kliniken an Zeit und Geld, um potenzielle Organspender zu identifizieren. Maag war der Ansicht, die Organspende sei eine bewusste und freiwillige Entscheidung, die weder erzwungen noch von der Gesellschaft erwartet werden dürfe. Deswegen führe die Widerspruchslösung in die falsche Richtung. Sie sei mit dem Selbstbestimmungsrecht unvereinbar. Ähnlich äußerte sich der frühere Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU/CSU).
Auch AfD lehnt Widerspruchslösung ab
Dem schloss sich Axel Gehrke (AfD) an. Die Widerspruchslösung sei "voller Baustellen" , hier bestünde auch die Gefahr des Missbrauchs. Und das ist wohl die größte Angst, die bei dem Thema im Raum steht: Dass Organe voreilig entnommen werden, selbst wenn der Spender vielleicht noch zu retten gewesen wäre. Sein Kollege Paul Viktor Podolay (AfD) sieht das ähnlich.
SPD hat verschiedene Lösungen parat
Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD) wies darauf hin, dass auch viele Kinder auf ein rettendes Organ warteten. Die Widerspruchslösung gelte in den meisten europäischen Ländern und einige Länder kämen auf erheblich mehr Organspender als Deutschland. Organisatorische Verbesserungen allein könnten nicht helfen. Es werde bei der Widerspruchslösung auch niemand zur Organspende gezwungen, vielmehr gehe es nur darum, dass jeder sich damit einmal befasse. Das sei ja auch ein Element der Selbstbestimmung.
Konkret plädierte Lauterbach für die erweiterte Widerspruchslösung. Dabei müssen bei dem Tod einer Person, die zu Lebzeiten keine eindeutige Aussage getroffen hat, die Angehörigen gefragt werden. Diese Methode würde vor Fehlern und Missbrauch schützen, so der Abgeordnete. Seine Kollegin Kerstin Griese (SPD) plädierte hingegen für eine verpflichtende Entscheidungslösung. Was ist das nun wieder? Erklären wir weiter unten im Absatz zur FDP.
CDU-Minister argumentiert gegen Fraktionskollegen
Anders als einige seiner Fraktionskollegen plädierte auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die Widerspruchslösung. Er mahnte, jeder könne einmal in die Situation kommen, ein Spenderorgan zu brauchen. Die erweiterte Widerspruchslösung sei zumutbar in einem Land, in dem so viele Menschen auf ein Organ warteten. Dabei könne schließlich jeder Mensch widersprechen, auch die Angehörigen noch. Das sei ja keine Organabgabepflicht. Die werde es nicht geben, dies dürfe auch nicht so dargestellt werden.
FDP: Verpflichtende Entscheidungslösung
Katrin Helling-Plahr und Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) sprachen sich hingegen gegen eine Widerspruchslösung aus, weil diese das Selbstbestimmungsrecht der Bürger missachte. Sie hatten noch eine ganz andere Lösung im Blick: Die verpflichtende Entscheidungslösung. Dabei muss jeder Mensch zwingend ein Statement zu seiner Spendenbereitschaft abgeben. Außerdem solle es ein zentrales Organspendenregister geben, in dem diese Entscheidung vermerkt wird. Organspendenausweise könnten ja auch verloren gehen.
Linke ist unentschieden
Dr. Petra Sitte (Die Linke) meinte hingegen, die Widerspruchslösung sei aus ihrer Sicht keine Bevormundung. Ihre Kollegin Katja Kipping (Die Linke) ging dabei nicht ganz mit. Sie plädierte für eine verbindlichen wiederkehrenden Abfrage. Dabei müsste jeder zwingend ja oder nein sagen und auch eine mögliche Änderung der Entscheidung würde damit möglich und zwingend dokumentiert.
Auch Grüne sind sich nicht einig
Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, dass ja viele Menschen spenden wollten, aber nur wenige diese Entscheidung bewusst getroffen und dokumentiert hätten. Mit der Widerspruchslösung kann sie sich dennoch nicht so recht anfreunden. Sie plädierte für eine verbindliche Abfrage der Spendenbereitschaft, etwa, wenn ein Personalausweis beantragt werde.
Baerbocks Kollegin Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen) gab der Debatte noch mal einen ganz anderen Dreh: Zu einer freien und selbstbestimmten Entscheidung, meinte sie, gehöre auch das Recht, nicht zu entscheiden – also weder dafür noch dagegen. Was dann allerdings rein praktisch wohl bedeuten würde: Wer sich gar nicht entscheidet, kann kein Spender sein.
(DBT/ah)