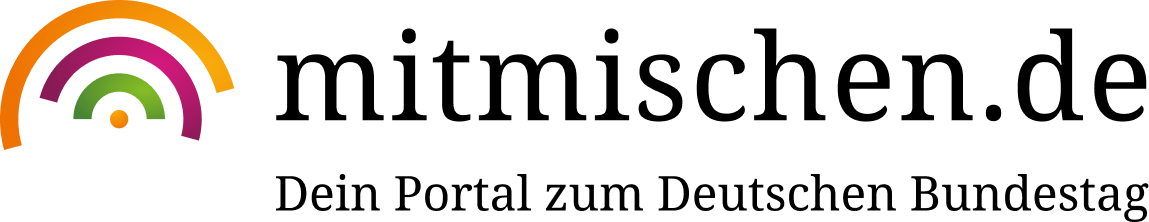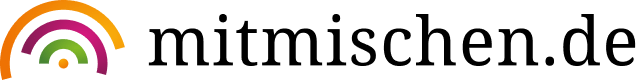Jugend und Parlament
„Vor uns sitzt das Parlament des Jahres 2040“
Jasmin Nimmrich
Zum Abschluss des Planspiels „Jugend und Parlament“ hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, den echten Abgeordneten und Amtsträgern des Parlaments Fragen zu den Strukturen des Deutschen Bundestages und zum Abgeordneten-Dasein zu stellen.

Nach dem viertägigen Planspiel „Jugend und Parlament“ sind die Rollen wieder getauscht und die Teilnehmer haben nun als Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den Abgeordneten Heidi Reichinnek (Die Linke), Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen), Götz Frömming (AfD), Derya Türk-Nachbaur (SPD), Hülya Düber und Ronja Kemmer (beide CDU/CSU) (v.l.n.r.) ihre Fragen zu stellen. © DBT/ Stella von Saldern
Das viertägige Planspiel „Jugend und Parlament“ ist vorbei. Es wurden fiktive Gesetzesentwürfe angenommen und abgelehnt, es wurde debattiert und ausgehandelt, ausprobiert, wie die Strukturen des parlamentarischen Systems funktionieren, und viel gelernt über den Deutschen Bundestag und den Arbeitsalltag der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Zum Abschluss steht wie in jedem Jahr eine Podiumsdiskussion mit denjenigen an, die das Reichstagsgebäude wirklich als ihren Arbeitsplatz bezeichnen können.
Dort, wo sonst die Vertreterinnen und Vertreter des Bundesrates Platz nehmen, sitzen nun Ronja Kemmer, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Hülya Düber, stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Derya Türk-Nachbaur, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Götz Frömming, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Britta Haßelmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, und Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Fraktion Die Linke, um sich von den wissbegierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Fragen löchern zu lassen.
Bei Demokratie müssen möglichst viele mitmachen
Los geht es mit einem Resümee der letzten Tage. Der Moderator Wulf Schmiese, stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, wirft die Frage in den Raum, wie viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach den Erfahrungen des Planspiels noch in Erwägung ziehen würden, eine politische Laufbahn einzuschlagen. Die überwiegende Mehrheit hebt die Hand. „Vor uns sitzt also das Parlament des Jahres 2040“, freut sich der Journalist über das politische Engagement der jungen Menschen.
Darum, wie sich das eigene politische Engagement mit dem Privatleben vereinbaren lässt und wie man sich am besten innerhalb der Strukturen einer Partei einbringt, drehen sich einige der Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ronja Kemmer (CDU/CSU), die selbst nach dem Abitur in die Junge Union, die Jugendorganisation der Unionsparteien, eingetreten ist, stellt klar, dass es für politisches Engagement vor allem ganz viel Herzblut und ein persönliches Themeninteresse braucht. Die Jugendorganisationen der Parteien seien auf jeden Fall ein guter Start, um die eigene politische Orientierung herauszufinden. Und auch wenn man der Ausrichtung der Jugendorganisation nicht zustimme, lebe die innerparteiliche wie auch die parlamentarische Demokratie von Kompromiss und Diskurs. Außerdem betont sie: „Demokratie überlebt nur, wenn möglichst viele mitmachen!“
Heidi Reichinnek (Die Linke), die selbst mit 27 in die Partei Die Linke eintrat, betont ebenfalls, dass es für politisches Engagement ein Thema brauche, für das man brenne: „Du musst etwas verändern wollen und nicht nur hier sein, weil du in der Politik sein willst.“ Außerdem sei es wichtig, den politischen Weg nicht alleine zu beschreiten, sondern sich auch innerhalb einer Partei mit Menschen zu umgeben, die einen unterstützen, wie auch herausfordern. An den Saal gerichtet ermutigt sie alle Anwesenden, den Schritt in die politische Verantwortung zu wagen, denn „ihr gehört alle hier in dieses Parlament, ihr gehört in die Landtage, weil ihr die Gesellschaft abbildet“.
Demokratie lebt von Kompromissbereitschaft
Konkreter zum Parlamentarier-Dasein wird es mit der Frage, wie die Abgeordneten damit umgehen, wenn die eigene politische Meinung von dem Standpunkt der eigenen Fraktion abweicht. Hülya Düber (CDU/CSU), die bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar diesen Jahres erstmals in den Deutschen Bundestag einzog, erläutert ihre Anspruchshaltung an sich selbst: Sie wolle auf Basis ihrer eigenen Fachexpertise entscheiden, sich selbst aber auch durch die Prozesse der parlamentarischen Meinungsbildung korrigieren. Authentizität, der gepflegte Dialog und Kompromissbereitschaft seien in jedem Parlament, egal ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, entscheidend für die politische Stabilität.
Auch Derya Türk-Nachbaur (SPD), die seit 2021 im Deutschen Bundestag sitzt, sieht angesichts der gegenwärtigen Krisen die Notwendigkeit, persönlich entscheidungsfreudig sowie fähig zu sein, die eigene Meinung zu hinterfragen und anzupassen. Als Abgeordnete würde man es sich selbst schwerer als nötig machen, wenn man die Expertise anderer nicht anerkenne. Auch über die Fraktionsgrenzen hinweg, beispielsweise während der Arbeit in den Ausschüssen, sei es enorm wichtig, voneinander zu lernen. „Kompromissbereitschaft ist das Zauberwort in der Demokratie“, so Türk-Nachbaur.
Über den Tellerrand blicken
Außerdem interessiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, inwieweit die Abgeordneten mit Menschen anderer politischer Meinung, inner- wie außerhalb des Parlamentes, in den Austausch treten. Für Götz Frömming (AfD), ehemaliger Gymnasiallehrer und nun unter anderem Mitglied des Ältestenrates, ist es wichtig, permanent bereit zu sein, sich mit Menschen auszutauschen, die eine andere politische Meinung haben, wie er erklärt. Gerade in seinem Wahlkreis im brandenburgischen Prignitz trete er mit Bürgerinnen und Bürgern in Austausch und diskutiere Themen, die die Menschen vor Ort betreffen würden. Man sei da nicht immer der gleichen Meinungen und das sei auch völlig in Ordnung, solange ein respektvolles Miteinander herrsche.
Auch für Heidi Reichinnek (Die Linke) stellt der Austausch mit Menschen außerhalb ihrer politischen Bubble einen wichtigen Teil ihres parlamentarischen Auftrags dar: „Nur im eigenen Wasser zu schwimmen, ist schlichtweg gefährlich“, resümiert Reichinnek, die vor ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag in der Jugendhilfe tätig war. Es brauche daher die Gespräche an Haustüren und auf den Bürgersteigen der Nation. Doch für sie existieren auch unüberbrückbare Differenzen, so beispielsweise, wenn sich eine Person rassistisch, sexistisch oder transfeindlich äußere. Davon abgesehen bereichere gerade der Austausch mit Wählerinnen und Wählern anderer Parteien auch ihre eigene politische Position und Überzeugung.
Ein Amt mit einem hohen Preis

Britta Haßelmann, die Co-Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen richtet das Wort insbesondere an die Teilnehmerinnen des Planspiels. Es brauche mehr Frauen im Deutschen Bundestag. © DBT/ Stella von Saldern
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten außerdem wissen, wie sich das Privatleben der Abgeordneten seit dem Einzug in das Parlament verändert hat. Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen), die bereits seit 2005 im Deutschen Bundestag sitzt und damit die Dienstälteste unter den anwesenden Abgeordneten ist, blickt zurück auf die Anfänge ihres parlamentarischen Daseins: Zu Beginn sei der Spagat zwischen der Anwesenheit in Berlin während der Sitzungswochen und der Zeit im Wahlkreis und bei der eigenen Familie eine Herausforderung gewesen. „Man führt in Berlin ein ganz anderes Leben“, das nur funktionieren könne, wenn das eigene Umfeld die persönliche Entscheidung mittrage und einen unterstütze. Darüber hinaus merkt sie an, wie es sie erzürne, dass nur weibliche Abgeordnete nach der Vereinbarkeit von Mandat und Familie befragt würden. Sie richtet ihren Appell an den vollen Saal: Der Frauenanteil im 21. Deutschen Bundestag sei mit 32 Prozent auf einem absoluten Tiefpunkt. Daran müsse sich dringend etwas ändern und eine Struktur geschaffen werden, in der mehr Frauen sich selbstbestimmt für den Schritt in die Politik entscheiden können.
Derya Türk-Nachbaur (SPD) weist dahingehend auf die zusätzliche Herausforderung von Frauen mit Migrationshintergrund hin, die in der Öffentlichkeit stehen. Man müsse sich drei Mal mehr beweisen, drei Mal lauter sein und drei Mal standhafter bleiben. Damit böte man aber auch drei Mal mehr Angriffsfläche. Sie selbst sei immer wieder von Neuem darüber schockiert, wie viel Projektionsfläche sie für Hass und Gewaltandrohungen, auch gegen ihre Kinder, böte. Der Einzug in den Deutschen Bundestag habe ihr Familien- und Privatleben daher sehr verändert. Der Preis sei hoch, doch sie brenne für das, was sie im Bundestag leisten und erreichen könne.
Ein Parlament, 630 Namen
Zum Schluss wird es nochmal praktischer: Wie können sich die Abgeordneten die Namen der vielen Personen merken, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben, möchte eine Teilnehmerin wissen. Ronja Kemmer (CDU/CSU) greift dafür auf die Notizfunktion ihres Handys zurück und verfasst nach dem Treffen mit einer neuen Person ein Memo an sich selbst, mit jeder weiteren Interaktion ergänzt sie die Notizen entsprechend. Hülya Düber (CDU/CSU) greift hingegen als neue Abgeordnete immer wieder gerne auf das kleine Büchlein zurück, das sich in der Schublade jedes Platzes im Plenarsaal befindet. In dem sogenannten Kürschner sind alle Namen und Gesichter der Abgeordneten vermerkt. So langsam würde sie zumindest die Gesichter aller Mitglieder der Fraktionen von CDU/CSU und SPD erkennen. DeryaTürk-Nachbaur (SPD) betont, dass es wichtig sei, sich sowohl die Namen derjenigen zu merken, die der Demokratie gut tun, als sich auch an die Namen derjenigen zu erinnern, die die Demokratie bekämpfen. Götz Frömming (AfD) merkt an, dass Namen und Gesichter besonders im Gedächtnis bleiben würden, wenn sie positiv oder negativ auffielen. Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen) hingegen schwört auf ihr persönliches Talent, sich Namen und Gesichter gut merken zu können, gerade der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen sei die perfekte Gelegenheit, diese Fähigkeit zu üben. Zu guter Letzt zeigt sich Heidi Reichinnek (Die Linke) etwas enttäuscht von den wenigen konkreten Tipps ihrer parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen, denn sie selbst könne sich Namen schlecht merken. Daher gelte, wie in jeder vergleichbaren Situation im Alltag, einfach nochmal nachzufragen, schließlich seien Abgeordnete auch nur Menschen wie du und ich.
Die Podiumsdiskussion in voller Länge
Deutscher Bundestag