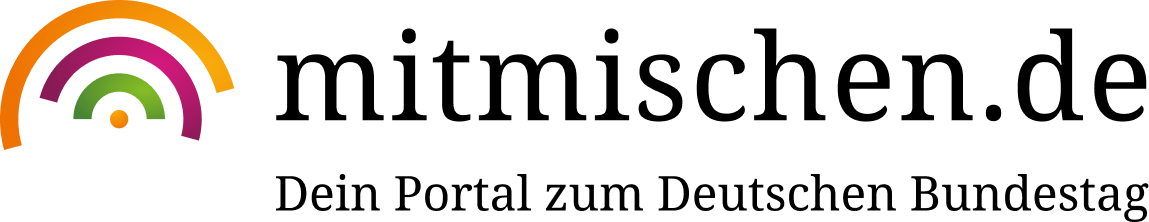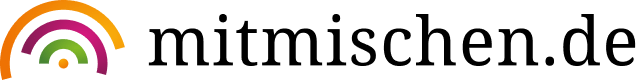Gremien
Welche weiteren Ausschüsse gibt es?
Jasmin Nimmrich
Für die Arbeit des Deutschen Bundestages spielen die Ausschüsse eine entscheidende Rolle, denn sie beraten unter anderem Gesetzesentwürfe und sprechen Empfehlungen für das Plenum aus. Doch es gibt noch weitere Gremien, die den reibungslosen Ablauf des parlamentarischen Geschehens sicherstellen sollen. Ein paar stellen wir euch hier vor:
Der Vermittlungsausschuss

Für die nicht öffentlichen Sitzungen des Vermittlungsausschusses treffen sich die Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates im Gebäude des Bundesrates.
© picture alliance/dpa | Christophe Gateau
Die Funktion des Vermittlungsausschusses steckt schon im Namen: Er vermittelt zwischen dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat. Beide Institutionen stellen jeweils die Hälfte der insgesamt 32 Gremiumsmitglieder, die im Falle des Bundestages nach den jeweiligen Fraktionsstärken benannt werden. Die 16 Mitglieder des Bundesrates vertreten jeweils ein Bundesland und werden von ihrer Landesregierung entsandt. Die Bundesratsmitglieder sind bei Ihrer Arbeit im Vermittlungsausschuss, anders als sonst, nicht an die Weisungen ihrer Landesregierung gebunden.
In der Vermittlerrolle ist der Ausschuss dafür zuständig, einen Konsens zwischen dem Bundestag und dem Bundesrat herzustellen. Dieser ist unter anderem nötig, wenn vom Bundestag beschlossene Gesetze keine Mehrheit im Bundesrat finden. Die Zustimmung des Bundesrates ist bei sogenannten Zustimmungsgesetzen notwendig, die entweder mit einer Grundgesetzänderung einhergehen, sich auf die Finanzen der Bundesländer auswirken oder in die Verwaltungs- und Organisationshoheit der Länder eingreifen. Wenn also abzusehen ist, dass der Bundesrat einem solchen Gesetzesvorhaben nicht zustimmen wird, nimmt der Vermittlungsausschuss seine Arbeit auf, um einen Kompromiss zwischen beiden Institutionen herzustellen.
Zu einem Vermittlungsergebnis kommt es dann, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Vermittlungsausschusses diesem zustimmt. Im Anschluss müssen sich dann sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat für dieses Ergebnis aussprechen. Die Arbeit des Vermittlungsausschusses passiert hinter verschlossenen Türen und auch die Protokolle der Ausschusssitzungen unterliegen einer Sperrfrist – erst in der jeweiligen übernächsten Legislaturperiode sind die Protokolle einsehbar.
Der Gemeinsame Ausschuss

Der Gemeinsame Ausschuss ist ein für den Verteidigungsfall konzipiertes Notparlament, das ständig besteht, in Friedenszeiten allerdings nicht regelmäßig zusammentritt. © IMAGO / Bihlmayerfotografie; picture alliance/dpa | Hauke Schröder
Der Gemeinsame Ausschuss nimmt seine Arbeit nur im absoluten Notfall auf, nämlich dann, wenn der Verteidigungsfall festgestellt würde und der Deutsche Bundestag nicht zusammentreten könnte. Er stellt dann das Notparlament, das entscheidungsfähig ist. Diese Vorbereitung auf Krisen gibt es in der Bundesrepublik erst seit 1969 mit der Einführung der Notstandsverfassung.
Sollte er zusammentreten, sitzen im Gemeinsamen Ausschuss 48 Personen, von diesen gehören 16 dem Bundesrat und 32 dem Deutschen Bundestag an. Den Vorsitz des Ausschusses hat die Bundestagspräsidentin inne. Als Notparlament darf der Gemeinsame Ausschuss weder das Grundgesetz ändern noch die Hoheitsrechte übertragen oder das Bundesgebiet neu gliedern. Der Gemeinsame Ausschuss ist zu Bonner Zeiten zu sogenannten Informationssitzungen zusammengetreten. Nach der Geschäftsordnung des Gemeinsamen Ausschusses waren zwei jährlich vorgesehen. Die Geschäftsordnung wurde 1993 geändert und Sitzungen sollten seitdem nur noch bei Bedarf stattfinden. Seitdem hat keine Sitzung stattgefunden.
Der Wahlprüfungsausschuss

Zur Arbeit des Wahlprüfungsausschusses kann es unter anderem gehören, die abgegebenen Stimmen nach einer Wahl nachzählen zu lassen. © IMAGO / nordpool
Ob eine Bundestagswahl oder eine Wahl zum Europäischen Parlament gültig war, darüber entscheidet der Deutsche Bundestag. Für diese Entscheidung beruft sich das Parlament unter anderem auf die Arbeitsergebnisse und Empfehlungen des Wahlprüfungsausschusses. Dieser untersucht, ob alle Regeln und Rechte während der Vorbereitung und Durchführung der Wahl eingehalten wurden. So muss unter anderem gewährleistet sein, dass alle Wählerinnen und Wähler frei entscheiden können, wem sie ihre Stimme geben, sie während der Stimmabgabe also nicht beeinflusst werden.
Die insgesamt neun Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses bereiten die Entscheidungen des Deutschen Bundestages über die Gültigkeit der Wahlen vor, indem sie den Einsprüchen, die gegen Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl erhoben worden, nachgehen. Für diese Untersuchung zieht der Ausschuss auch die Bundeswahlleiterin zu Rate, die selbst keine Enscheidungshoheit im Prüfungsverfahren hat, aber den Ausschuss mit Informationen und Einschätzungen unterstützt. Auf Basis der Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses entscheidet dann im Anschluss der Deutsche Bundestag, ob alle Rechte bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl eingehalten wurden.
Der Wahlprüfunsausschuss tritt also dann zusammen, wenn Einsprüche gegen eine Bundestagswahl oder Wahl zum Europäischen Parlament erhoben worden. Aber auch der Bundestag selbst kann den Wahlprüfungsausschuss einberufen, wenn er Anhaltspunkte für konkrete Wahlfehler oder Unregelmäßigkeiten im Ablauf erkennt. Einspruch gegen die Vorbereitung oder Durchführung einer Bundestagswahl oder Wahl zum Europäischen Parlament können alle Wahlberechtigten innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten nach dem Wahltag erheben. So gingen zur Bundestagswahl 2025 1.029 Einsprüche ein, die sich unter anderem mit der Übersendung der Briefwahlunterlagen an im Ausland lebende Wahlberechtigte oder dem knappen Scheitern des BSW an der Fünf-Prozent-Hürde beschäftigten.
Das parlamentarische Kontrollgremium

Die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums werden in jeder Legislaturperiode von den Abgeordneten des Bundestages neu gewählt. © IMAGO / Political-Moments
Das parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) hat die Nachrichtendienste des Bundes genau im Blick. Denn dieses Gremium kontrolliert die Tätigkeiten der Bundesregierung in Sachen des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die Bundesregierung muss das PKGr umfassend über die Tätigkeiten der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung unterrichten. Das Kontrollgremium hat darüber hinaus das Recht, weiterführende Berichte von der Bundesregierung einzufordern.
Jeweils zur Mitte und am Ende einer Legislaturperiode erstattet das parlamentarische Kontrollgremium dem Deutschen Bundestag Bericht über seine Kontrolltätigkeiten. Während der restlichen Zeit unterliegen die Beratungen des PKGr strikter Geheimhaltung. Zu Beginn der Wahlperiode werden die Mitglieder des Kontrollgremiums mit einer Kanzlermehrheit, also mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages, gewählt. In der 21. Legislaturperiode besteht das Gremium aus neun Mitgliedern.
Enquete-Kommissionen

In seiner 18. Sitzung am 10. Juli hat der 21. Deutsche Bundestag entschieden, eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie einzusetzen. © IMAGO / Political-Moments
Eine Enquete-Kommission gleicht einer Arbeitsgruppe, in der Abgeordnete aus allen Fraktionen zusammenkommen, um sich intensiv mit einem Sachthema zu beschäftigen. Im Ende der Arbeit einer Enquete-Kommission sollen Empfehlungen für die Gesetzgebung entstehen. Um eine Enquete-Kommission einzusetzen, ist die Zustimmung von mindestens einem Viertel aller Abgeordneten notwendig.
Teil der Kommission sind zu gleicher Anzahl benannte Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen und externe fachspezifische Expertinnen und Experten. Am Ende der Zusammenarbeit, in der Beratungen und Anhörungen stattfinden, entsteht ein Bericht, der dem Parlament zur Diskussion vorgelegt wird und der Vorschläge zur Gesetzgebung enthält.
Am 10. Juli 2025 stimmte der 21. Deutsche Bundestag für die Einsetzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“, die ihren Abschlussbericht bis zum 30. Juni 2027 vorlegen soll. In der Vergangenheit widmeten sich Enquete-Kommissionen des Bundestages Themen wie „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“ (2022–2025), „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ (2018–2021) oder „Künstliche Intelligenz - Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ (2018-2020).