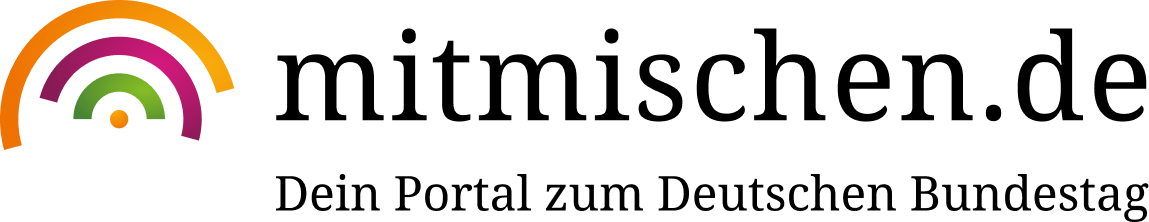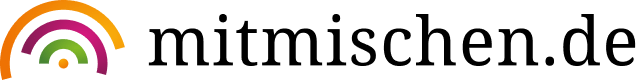Direkte Demokratie
Im Namen des Volkes
Wird die Politik besser, wenn alle immer mitreden können? Bei einer öffentlichen Anhörung war die direkte Demokratie auf Bundesebene auch unter Experten stark umstritten.

Der Verein "Mehr Demokratie" kämpfte schon 2017 für Volksabstimmungen auf Bundesebene. © dpa
Linke will mehr direkte Demokratie
Die parlamentarische Demokratie, in der Volksvertreter stellvertretend für die Wähler Entscheidungen treffen, ist mitunter umstritten. Kritiker bemängeln, dass die Abgeordneten doch keine Ahnung von den wirklichen Sorgen der Menschen hätten. Politiker kontern, dass es "Profis" brauche, um die komplexen Probleme dieser Welt managen zu können. Die Linksfraktion hat sich jetzt im Bundestag für mehr direkte Demokratie starkgemacht. Eine Anhörung im Innenausschuss zeigte, dass deren Gesetzentwurf dazu auch unter Experten äußerst umstritten ist.
Worum geht es?
Oft haben wir nur indirekt Einfluss auf die Politik. Wir wählen ganz demokratisch unsere Volksvertreter, die dann in unserem Sinne Entscheidungen treffen. Eben als unsere Vertreter, das ist unser System der repräsentativen Demokratie. Der Unterschied zur direkten Demokratie ist, dass wir bei der letzteren einzelne politische Fragen konkret selbst entscheiden, zum Beispiel durch Volksentscheide.
In verschiedenen deutschen Bundesländern und Gemeinden sind direktdemokratische Elemente wie Volksbefragungen, Bürgerentscheide und auch Volksbegehren vorgesehen. Auf Bundesebene gibt es die aber nicht, so ist es im Grundgesetz festgelegt. Die Linke will nun Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide auch auf Bundesebene durchsetzen sowie die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Außerdem sollen auch alle Menschen ohne deutschen Pass wählen dürfen, sofern sie mindestens fünf Jahre in Deutschland leben.
Auf Länderebene geht's
Begrüßt hat den Gesetzentwurf unter anderem Ralf-Uwe Beck vom Verein "Mehr Demokratie". Während auf Länderebene die parlamentarische Demokratie durch die direkte Demokratie ergänzt worden sei, fehle sie auf Bundesebene völlig, sagte er. Dabei habe sich dieses Mittel bewährt. Von Befürchtungen, die direkte Demokratie könnten von Populisten missbraucht werden, wollte Beck nichts wissen.
Ab in die Sackgasse
Vor einer "direktdemokratischen Sackgasse" warnte hingegen Prof. Dr. Otto Depenheuer von der Universität zu Köln. Auch er sieht die Demokratie derzeit unter Druck. Als Antwort darauf sei aber nicht die direkte Demokratie geeignet, sondern vielmehr der Ausbau der repräsentativen Demokratie. Depenheuer will auch das Wahlalter nicht absenken. Wenn man es täte – also den Jugendlichen mehr Rechte gebe – müssten sie auch auf anderem Gebiet als Erwachsene behandelt werden: Wenn 16-Jährige wählen dürften, müsste für sie auch das Strafrecht für Erwachsene gelten. Was sicherlich "aus guten Gründen" auf Ablehnung stoßen dürfte.
Die Sache mit den Bürgerräten
Katharina Liesenberg vom Verein "mehr als wählen" hat noch eine andere Idee. Sie will Bürgerräte einführen, die sich mit den Themen der anstehenden direktdemokratischen Entscheidung intensiv befassen sollen, alle Informationen zusammentragen und sich dann eine Meinung bilden. Die Räte würden dabei ausgelost. Mit einer sogenannten "qualifizierten Zufallsauswahl" würden dabei Alter, Geschlecht und Region berücksichtigt, so dass die Räte die Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegeln.
Das Plebiszit und der Volkswille
Prof. Dr. Otto Hans J. Lietzmann von der Universität Wuppertal sieht in dem Gesetzentwurf den richtigen Ansatz. Was aber, wenn das Volk allen Fakten zum Trotz gegen die eigenen Interessen entscheidet, wie zum Beispiel beim Brexit? Das sei ein Plebiszit gewesen und keine direkte Demokratie, so Lietzmann. Auf Nachfrage erklärte der Professor: Der Brexit war die Abstimmung über eine Idee der Regierung (Drinbleiben in der EU oder nicht), "echte" direkte Demokratie hieße aber, dass auch die Initiative "von unten" kommen müsse. Das Wahlalter will Lietzmann auch absenken, den Vergleich mit dem Strafrecht will er nicht gelten lassen und mit dem Ausländerwahlrecht soll sich das Bundesverfassungsgericht befassen.
Skepsis am Schweizer Modell
Prof. em. Dr. Regina Ogorek von der Goethe-Universität Frankfurt am Main hat die direkte Demokratie in der Schweiz näher kennengelernt und hat nun Zweifel, dass diese was bringt. Hinter der Idee stehe der Wunsch oder der Traum, dass man dadurch einen verantwortungsbewussteren, aufgeklärteren Bürger bekomme. Daran hat die Expertin aber Zweifel. Denn die Bürger würden in die komplexen Entscheidungsprozesse gar nicht eingebunden, sie hätten lediglich die Chance, am Ende Ja oder Nein zur Vorlage zu sagen. Zudem hätten Umfragen gezeigt, dass bei wichtigen Abstimmungen mehr als die Hälfte der Teilnehmer nicht gewusst hätte, worüber wirklich abgestimmt wurde.
Die Deutschen – eine "Abstammungsgemeinschaft"
Die Einführung eines Ausländerwahlrechts "selbst durch verfassungsänderndes Gesetz" ist aus Sicht des Privatdozenten Dr. Ulrich Vosgerau unmöglich. Die Einführung durch einfache Gesetze wäre in jedem Falle verfassungswidrig, wie auch das Bundesverfassungsgericht geurteilt habe. Der Gedanke, man müsse das Ausländerwahlrecht einfach nur in die Verfassung hineinschreiben, damit das Gericht es nicht als verfassungswidrig bewerten könne, sei "zu kurz gedacht". Er argumentierte: Das "deutsche Volk" sei nun mal eine "Abstammungsgemeinschaft".
Die Anhörung (hier könnt ihr sie übrigens auch komplett sehen) dürfte den Abgeordneten die Entscheidung nicht unbedingt leichter gemacht haben. Abstimmen müssen sie demnächst trotzdem über den Gesetzentwurf der Linken. Dabei hat das Volk erst mal noch keine Entscheidungsgewalt.
(DBT/ah)