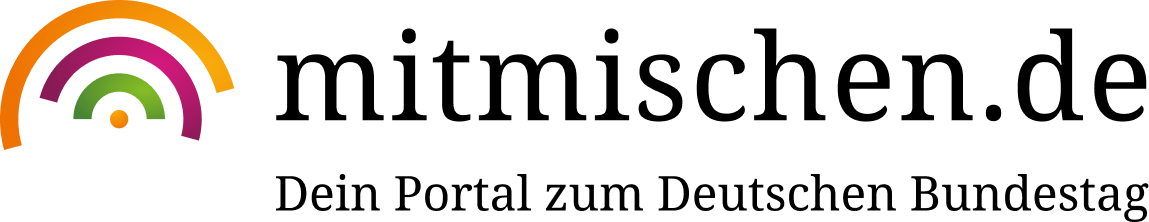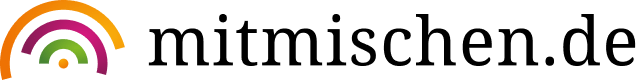IPS Arabische Staaten 2025
Demokratie ist nie selbstverständlich
Naomi Webster-Grundl
Wie hat sich die Demokratie in Deutschland entwickelt? Wie stabil ist sie und wie kann sie sich selbst schützen? Darüber haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Parlaments-Stipendiums Arabische Staaten mit dem Politikwissenschaftler Stefan Marschall gesprochen.

Der Politologe Prof. Dr. Marschall erläutert den Stipendiatinnen und Stipendiaten die Grundzüge und Herausforderungen der deutschen Demokratie. © mitmischen.de / Naomi Webster-Grundl
Einen Monat lang lernen junge Menschen im Rahmen des Internationalen Parlaments-Stipendiums Arabische Staaten den parlamentarischen Betrieb des Deutschen Bundestages kennen. An diesem Tag ist der Politologe und Professor für Politikwissenschaften Prof. Dr. Stefan Marschall bei den Stipendiaten zu Gast, um ihnen die Grundzüge und Herausforderungen des politischen Systems in Deutschland genauer vorzustellen.
Das Grundgesetz als Grundlage der Demokratie
Die meisten der Stipendiatinnen und Stipendiaten haben Germanistik studiert und wissen viel über Deutschland, seine Geschichte und das aktuelle politische Geschehen. Einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits während ihres Studiums mit der arabischen Übersetzung des deutschen Grundgesetzes gearbeitet haben.
Prof. Dr. Marschall fragt die jungen Leute, die aus Ägypten, Algerien, Tunesien, Marokko und dem Irak kommen, nach dem ersten Artikel ihrer nationalen Verfassung. Es fällt auf, dass es dabei um die Staatsprinzipien des jeweiligen Landes geht. Diese sind im deutschen Grundgesetz im Artikel 20 geregelt: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Artikel 1 des Grundgesetzes stellt die Würde des Menschen in den Mittelpunkt, eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus, als diese missachtet wurde.
Die Geschichte kennen, um zu verstehen
Generell, erklärt Prof. Dr. Marschall, könne man ein politisches System meist nur dann komplett verstehen, wenn man sich die Geschichte des jeweiligen Landes anschaue. Deutschland hatte nach der Kaiserzeit mit der Weimarer Republik bereits eine Demokratie. Warum ist diese Demokratie gescheitert und welche Lehren wurden daraus gezogen? Zum Beispiel wurden als historische Konsequenz die politischen Rechte des Bundespräsidenten in der aktuellen deutschen parlamentarischen Demokratie stark begrenzt.
Prof. Dr. Marschall zeigt auch die Ergebnisse einer RTL/ntv-Trendbarometer-Umfrage vom Dezember 2024, die zeigen, wie hoch das Vertrauen der Deutschen in die politischen Institutionen ist. Das Bundesverfassungsgericht führt mit 78 Prozent, der Bundespräsident kommt auf 61 Prozent, der Bundestag auf 32 Prozent, die Bundesregierung und der Bundeskanzler nur auf jeweils 22 Prozent.
Spitzenreiter des Vertrauens: Das Bundesverfassungsgericht
Auf die Frage an die Stipendiaten, warum sie glauben, dass das Bundesverfassungsgericht so großes Vertrauen genieße, äußern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Theorien: Zum einen sei diese Institution nicht stark mit einzelnen Amtspersonen verknüpft, da Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in der Regel weniger medial politisiert würden, zum anderen wüssten die Bürger, dass sie dort ihre Rechte einklagen können. Auch würden Bürgerinnen und Bürger dem Bundesverfassungsgericht keine Verantwortung für eine negative wirtschaftliche Entwicklung zuschreiben.
Prof. Dr. Marschall erklärt, dass bisher keine Konflikte beim Bundesverfassungsgericht nach außen sichtbar gewesen seien. Es sei nun abzuwarten, ob die politische und mediale Debatte rund um die Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf als Richterin Auswirkungen auf die Reputation des höchsten deutschen Gerichts haben werde. Gerade in Zeiten des sogenannten „democratic backslidings“, womit der Rückgang demokratischer Qualitäten eines politischen Systems beschrieben werde, sei es umso wichtiger, übergeordnete Institutionen zu haben, die „alles etwas zusammenhalten“, so Prof. Dr. Marschall.
Blick zurück und nach vorne
Auch der Blick auf die Entwicklung der Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 wirft viele Fragen und Gesprächsbedarf bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten auf: Warum wurden alle Regierungsparteien deutlich abgestraft? Wieso kann eine Partei ihr Ergebnis verdoppeln? Sind die Deutschen traditionell „Sicherheitswähler“? Kann man Prognosen für die nächste Bundestagswahl anstellen? Welche Risiken bestehen, wenn das Parteiensystem immer weiter aufsplittert?
Auch wenn das demokratische System in Deutschland ziemlich stabil aufgebaut sei, müsse allen klar sein, dass Demokratie nie selbstverständlich sei, so Prof. Dr. Marschall. Gerade in den aktuell unruhigen und teils unberechenbaren Zeiten durch Entwicklungen auf der ganzen Welt, sei es umso wichtiger, die Demokratie wehrhafter zu machen.