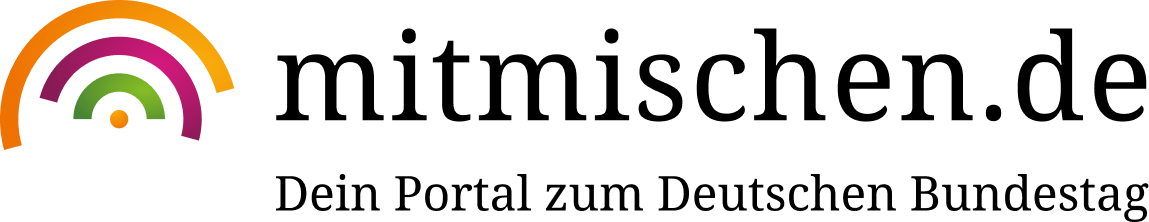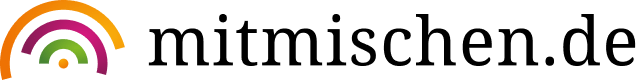Jugend und Parlament
Demokratie ist Diskurs
Naomi Webster-Grundl
Der Höhepunkt des Bundestags-Planspiels „Jugend und Parlament“ ist ohne Zweifel die Debatte im Plenum. Wer bringt welche Argumente vor? Welcher Gesetzentwurf bekommt eine Mehrheit? mitmischen.de war im Plenarsaal dabei.

Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Tage in Ausschüssen und Fraktionen über die fiktiven Gesetzentwürfe diskutiert haben, kam es zur finalen Abstimmung im Plenum. © DBT/Stella von Saldern
Es herrscht wuseliges Treiben im Plenarsaal, die fiktiven Abgeordneten des Planspiels „Jugend und Parlament“ unterhalten sich und nehmen langsam ihre Plätze ein. Wie bei den echten Abgeordneten ergibt sich ein gemischtes Bild: Viele tragen Anzug, Hemden, Blusen, man sieht aber auch Jeans und Pullover. Nur das Durchschnittsalter ist deutlich niedriger als sonst – die mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Planspiels sind zwischen 17 und 20 Jahren alt.
Als der Gong ertönt, eilen schnell alle zu ihren Plätzen und plötzlich ist es ganz still, als Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour den Saal betritt, die Vier-Tages-Abgeordneten begrüßt und die Sitzung eröffnet. Neben ihm sitzen immer zwei Rollenspiel-Schriftführer, die ihn dabei unterstützen, den Saal im Blick zu haben – alle halbe Stunde wird hier gewechselt. Nach den obligatorischen Geburtstagsglückwünschen beginnen die Aussprachen.

In den Plenarsaal dürfen sonst nur Abgeordnete – es ist also eine ganz besondere Gelegenheit, als Teilnehmer von „Jugend und Parlament“ dort Platz zu nehmen. © DBT/Stella von Saldern
Souveräne Reden, einstimmiges Ergebnis
Die fiktive Koalition besteht aus der Gerechtigkeitspartei (GP) und der Partei für Engagement und Verantwortung (PEV). Die Bewahrungspartei (BP) bildet die Opposition. In der ersten Debatte befassen sich die Jugendlichen in ihren Rollen als Parlamentarier mit dem von der fiktiven Regierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Beschränkung ausländischer Investitionen in kritische Infrastruktur.
Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die die Gelegenheit haben, ans Rednerpult zu treten, sehr aufgeregt sind. Anmerken lassen sich das die meisten jedoch nicht. Sie sprechen souverän, gestikulieren, wie sie es teils sicherlich in der ein oder anderen Plenardebatte gesehen haben, agieren angriffslustig oder wollen vor allem ihre inhaltlichen Argumente vorbringen. Von den anderen Rollenspiel-Abgeordneten gibt es viel Applaus.
In dieser ersten Debatte sind sich die drei Fraktionen inhaltlich sogar weitestgehend einig: Bei diesem Gesetzentwurf geht es nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um die nationale Sicherheit. Am Ende wird der Entwurf einstimmig angenommen. Kleine Sticheleien in die „gegnerische“ Richtung lassen sich einige Abgeordnete aber natürlich trotzdem nicht nehmen.
Omid Nouripour bedankt sich für die Art und Weise, wie die fiktiven Abgeordneten miteinander diskutieren. „Möge sich das andere Parlament, das hier manchmal tagt, eine Scheibe davon abschneiden.“ Damit möglichst viele Teilnehmer eine Rede halten können, beträgt die Redezeit pro Sprecherin und Sprecher nur zwei Minuten. Nur wenige müssen dahingehend ermahnt werden, dass sie ihre Redezeit überschreiten.

Die Bundesvizepräsidenten Bodo Ramelow (links) und Omid Nouripour (rechts) hatten auch Spaß an den Sitzungen des fiktiven Parlaments. © DBT/Stella von Saldern
Konstruktive Zusammenarbeit
Nachdem Omid Nouripour von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow abgelöst wurde, beginnt die Aussprache zu dem vom fiktiven Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung einer Klarnamenpflicht in digitalen Medien.
Auch hier herrscht unterm Strich Einigkeit: Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Doch auszudiskutieren gibt es trotzdem so einiges: Was ist notwendiger Schutz und was führt zu Angst bei freier Meinungsäußerung? Einige der Abgeordneten bedanken sich bei allen Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit in den Ausschüssen. Ein paar Vorwürfe fehlen trotzdem nicht („Das ist ein Maulkorbgesetz!“, „Sie haben wohl den Änderungsantrag nicht gelesen!“) – gerade dieses schauspielerische Aus-sich-Herausgehen scheint den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß zu machen.
Am Ende der Debatte wird der Gesetzentwurf, der dahingehend geändert wurde, dass es keine Klarnamenpflicht gibt, sondern eine individuelle E-ID, durch die Aussagen im Internet klar zugeordnet werden können, einstimmig angenommen. Ein fiktiver Abgeordneter fasst zusammen: „Das zeichnet Demokratie aus: Dass man sich einigen kann.“
Wie im echten Bundestag
Auch Bodo Ramelow bedankt sich für die spannende Debatte, bevor er den nächsten Tagesordnungspunkt aufruft: der von der fiktiven Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf zur verpflichtenden Installation von Solarzellen auf Dächern.
Jetzt werden die Redebeiträge härter im Ton. Die Verhandlungen in den Ausschüssen scheinen schwierig gewesen zu sein. Die Koalition wirft der Opposition vor, die Gespräche abgebrochen zu haben. Die Opposition wirft hingegen der Koalition vor, sie für eine Sicherung der Zweidrittelmehrheit bei der noch ausstehenden Debatte zu erpressen. Alle sind für Klimaschutz, doch über das Wie sind sie sich nicht einig: Ist der vorliegende Vorschlag ein Zwangsgesetz oder ein Verantwortungsgesetz?
Alle nehmen das Planspiel sehr ernst, verfolgen die Debatte mit ungeteilter Aufmerksamkeit und die Redebeiträge könnten sofort in einer echten Plenardebatte so gehalten werden. Auch bei dieser Abstimmung fühlt man sich einmal mehr wie im realen Bundestag, denn die Koalition nimmt die eigenen Änderungsanträge und den Gesetzentwurf an, die Opposition stimmt dagegen und bekommt keine Mehrheit für die eigenen Vorschläge.
Leidenschaftlich argumentieren, andere Meinungen tolerieren
Bei der letzten Debatte geht es um eine mögliche Grundgesetzänderung, um Menschen aus anderen EU-Ländern, die in Deutschland leben, das Bundeswahlrecht zu ermöglichen. Die Koalitionsfraktionen sind sich einig: Wer in Deutschland lebt, arbeitet und Steuern zahlt, seine Kinder großzieht, soll auch an der Politik mitwirken und auf Bundesebene wählen dürfen.
Die Abgeordneten der oppositionellen Bewahrungspartei machen in ihren Redebeiträgen klar, dass sie diesen Ansatz und eine Änderung des Grundgesetzes entschieden ablehnen. Das Wahlrecht sei kein Mittel zur Integration, sondern ein Lohn für einen abgeschlossenen Integrationsprozess, mit dem der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit einhergehe.
Es wird sehr unruhig im Plenum, die Koalition und Opposition überhäufen sich mit Vorwürfen, wer daran Schuld trage, dass es zu keinerlei Einigung kommen konnte. Vizepräsidentin Andrea Lindholz, die inzwischen den Vorsitz übernommen hat, muss mehrmals zur Ordnung rufen.

Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz und die Planspiel-Schriftführer beobachten, was während der Reden im Plenum geschieht und ob jemand eine Zwischenfrage stellen möchte. © DBT/Stella von Saldern
Bei der Abstimmung kommt die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht zustande – die Vizepräsidentin und die fiktiven Schriftführer zählen mehrfach nach –, die Grundgesetzänderung ist damit abgelehnt. Ein Raunen geht durch den Plenarsaal, als auch einzelne Abgeordnete der Koalitionsfraktionen dagegen stimmen. „Abstimmungen werden nicht kommentiert“, mahnt Vizepräsidentin Lindholz.
Somit ist die Sitzung geschlossen. Zwei von vier Gesetzentwürfen wurden sogar einstimmig angenommen, keine schlechte Bilanz für Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft. „Das war sicherlich ein sehr guter Einblick in die parlamentarische Arbeit und auch, wie schwierig die Aufgabe des Präsidiums manchmal ist“, fasst Andrea Lindholz zusammen. „Politik bedeutet, leidenschaftlich für eigene Überzeugung einzutreten, aber auch die Meinung anderer zu tolerieren und zu akzeptieren.“
Gesicht für die Demokratie zeigen
Zum Abschluss kommt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in den Plenarsaal. Auch wenn kein Gong ertönt, erheben sich alle fiktiven Abgeordneten von ihren Plätzen. Sie zeigt sich begeistert darüber, dass so viele junge Leute aus ganz Deutschland für dieses Planspiel in den Bundestag gekommen sind und vermutet: „Vielleicht denken ja nun manche von Ihnen, dass sie Politikerin oder Politiker werden wollen.“ Sie betont, wie großartig es sei, in einem Land zu leben, in dem es allen offen stehe, eine politische Karriere einzuschlagen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ermutigt die Planspiel-Teilnehmer, sich weiterhin politisch zu engagieren. © DBT/Stella von Saldern
„Seid selbstbewusst, aber nicht selbstgerecht. Man kann auch mal falsch liegen. Das Argument muss zählen und nicht die Lautstärke und Inszenierung.“ Sie ruft dazu auf, immer auch nach links und rechts zu schauen und Informationen nicht nur aus dem eigenen Algorithmus zu beziehen, da es viele verschiedene legitime Meinungen gebe. „Gewählte Abgeordnete sind das Abbild der Gesellschaft. Sich zur Wahl stellen heißt auch, dass man verlieren kann, aber das ist nicht peinlich. So funktioniert Demokratie. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sagt: Ich zeige Gesicht für unsere Demokratie.“

„Jugend und Parlament“ 2025 ist vorbei – ein Gruppenbild im Plenarsaal mit der Bundestagspräsidentin darf da nicht fehlen. © DBT/Inga Haar