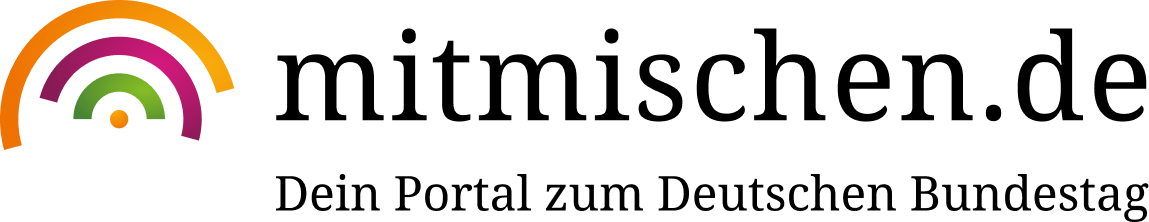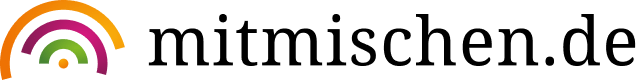Anhörung im Verteidigungsausschuss
Wie soll der Wehrdienst modernisiert werden?
Jasmin Nimmrich
In einer Anhörung des Verteidigungsausschusses hatten unter anderem Sachverständige aus der Bundeswehr und der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, sich zu dem Entwurf des Wehrdienst-Modernisierungsgesetz zu positionieren.

Die Sachverständigen saßen während der Anhörung den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses gegenüber und beantworteten die Fragen der Abgeordneten zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Thomas Röwekamp (CDU/CSU), der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, eröffnete die 12. Sitzung des Verteidigungsausschusses des 21. Deutschen Bundestages, die sich mit dem Entwurf zum Wehrdienst-Modernisierungsgesetz befasste. Zur Anhörung waren sechs Sachverständige aus Wissenschaft, Bundeswehr und Zivilgesellschaft geladen: Prof. Dr. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam, Oberst André Wüstner vom Deutschen Bundeswehrverband e.V., Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak und Generalleutnant Robert Sieger vom Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Die Perspektiven und Interessen der jungen Menschen brachten Quentin Gärtner, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, und Daniela Broda vom Deutschen Bundesjugendring e.V. mit in die Anhörung. Nach ihren Eingangsstatements und ihren Einschätzungen zum vorliegenden Gesetzentwurf stellten sich die Expertinnen und Experten den Fragen der Mitglieder des Verteidigungsausschusses.
Eine Frage der Freiwilligkeit
Dass es, vor allem angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und einem Ausbau der Bundeswehr bedarf, darüber waren sich alle Sachverständigen einig. So bezeichnete der Militärhistoriker Sönke Neitzel den vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung als einen „Schritt in die richtige Richtung“, jedoch handle es sich seiner Einschätzung nach auch um ein „Dokument des Zöderns und Zauderns“. Denn die darin vorgesehene Freiwilligkeit werde nicht ausreichen. Die angegebenen Zielgrößen von 280.000 aktiven Soldaten und 200.000 Reservisten seien „nicht schlüssig abgeleitet“, den eigentlichen Bedarf für Abschreckung und Verteidigung würde er deutlich höher beziffern.
Auch für Oberst Wüstner vom Deutschen Bundeswehrverband habe „der Handlungsdruck zugenommen“, gerade weil die politische Antwort der Diplomatie im Falle Russlands „hoffnungslos“ sei. Es müsse auf Abschreckung sowie Vorbereitung für den Ernstfall gesetzt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt sei die Infrastruktur der Bundeswehr aber bereits überplant, es bestehe also akuter Handlungsdruck, um Mensch und Gerät auf eine größere Truppe vorzubereiten. Die vorläufige Freiwilligkeit des Wehrdienstes, wie sie im Gesetzesentwurf der Bundesregierung festgehalten ist, wäre daher auch für die Bundeswehr selbst ein zeitlicher Vorteil. Sollte die Freiwilligkeit unter den Wehrfähigen jedoch hinter den Erwartungen zurück bleiben, würde er für einen Umschaltmechanismus im Sinne des schwedischen Modells plädieren. In Schweden werden alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gemustert. Während der Musterung wird mittels eines Fragebogens auch die Motivation getestet. Anhand der physischen und psychischen Ergebnisse wählt das Militär selbst aus, wer zum verpflichtenden Wehrdienst eingezogen wird.
Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak fand für den vorerst auf Freiwilligkeit beruhenden Ansatz härtere Worte. Als „deutlich unterambitioniert“ bezeichnete er die Vorhaben des Gesetzesentwurfs. Die Konstruktion rund um Freiwilligkeit werde seiner Einschätzung nach scheitern und der Bundeswehr nicht zur Verteidigungsfähigkeit verhelfen. Daher forderte er, die Musterung aller Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 im Gesetz festzuhalten. Es sei an der Zeit, aus den gegenwärtigen Folgen der Aussetzung des Wehrdienstes im Jahr 2011 zu lernen, die er als einen „großen strategischen Fehler“ bezeichnete.
Attraktivität als Antwort?
Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr wurde vertreten durch seinen Präsidenten, den Generalleutnant Robert Sieger. Um junge Menschen für den Wehrdienst zu begeistern, müsse eine Steigerung der Attraktivität des Dienstes erfolgen. So seien die Erstattung der Kosten für den Führerschein, die Ansammlung von Rentenpunkten und eine ansprechende Besoldung mögliche Stellschrauben. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sei die Sinnstiftung, die im besten Fall mit dem Dienst einhergeht. Mit attraktiven Rahmenbedingungen und einer erfüllenden Aufgabe könne der Schutz der eigenen Heimat für junge Menschen ansprechend gestaltet werden. Durch bereits erfolgte Attraktivitätsmaßnahmen würde die Bundeswehr bereits ein gestiegenes Interesse wahrnehmen. Für den Personalzuwachs durch eine Wehrpflicht würde bereits heute geplant, entsprechende Anlagen anzumieten und die Musterung nicht in Kasernen durchzuführen. Denn die „Musterung muss hell, freundlich und motivierend sein”, so Sieger.
„Wir junge Menschen sind die kritische Infrastruktur“
Quentin Gärtner, der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Jahrgang 2008 und damit von den debattierten Plänen betroffen, brachte in die Debatte die „entscheidende zivile Säule“ mit ein und stellte die Frage, ob die jungen Menschen, über deren Einsatz an der Waffe diskutiert werde, überhaupt genug darauf vorbereitet seien. Es brauche vor allem Investitionen in die Bildung und eine Debattenkultur, in der diejenigen, über deren Zukunft entschieden werde, auch einen Platz am Tisch hätten. Denn „wir junge Menschen sind die kritische Infrastruktur“ über die gegenwärtig diskutiert werde. Für ihn sei es unverständlich, „wie man sich nicht mit den Betroffenen auseinandersetzen kann, um ein gutes Gesetz zu schmieden“, diese Herangehensweise sei schlichtweg falsch. Besonders, wenn man bedenke, dass die Generation, die von einer Wehrpflicht betroffen wäre, unter anderem auch durch die Auswirkungen der Klimakrise deutlich mehr leisten müssen werde, als sie von der restlichen Gesellschaft und Politik zurückerhalte.
Auch Daniela Broda vom Deutschen Bundesjugendring prangerte den vorgelegten Gesetz der Bundesregierung an und formulierte den Vorwurf, dass die jungen Menschen nicht als gleichberechtigte Bürger, sondern als naheliegende Ressource betrachtet würden. Sie fragte, warum die Freiwilligkeit anderer Altersgruppen in der gesamten Debatte gar keine Rolle spiele. Generationengerechtigkeit bedeute auch, dass die Verantwortung für das Land und dessen Sicherheit aufgeteilt werde. Die Wehrerfassung solle daher auch ältere Altersgruppen umfassen. Darüber hinaus kritisierte sie die Fokussierung auf Rekrutierungsquoten sowie die erfolgten Kürzungen für den Bundesfreiwilligendienst. Junge Menschen sollten auch in Zukunft selbst bestimmen können, wie sie sich für ihr Land engagieren wollen, egal ob bei der Bundeswehr oder in Form eines Freiwilligendienstes.
Die Anhörung in voller Länge
Die Erkenntnisse aus der Anhörung wird der Verteidigungsausschuss nun in seine Beratungen mit einbeziehen. Thomas Röwekamp kündigte an, dass am Mittwoch, 3. Dezember, die letzte Sitzung des Ausschusses zum „Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes“ stattfinden wird.